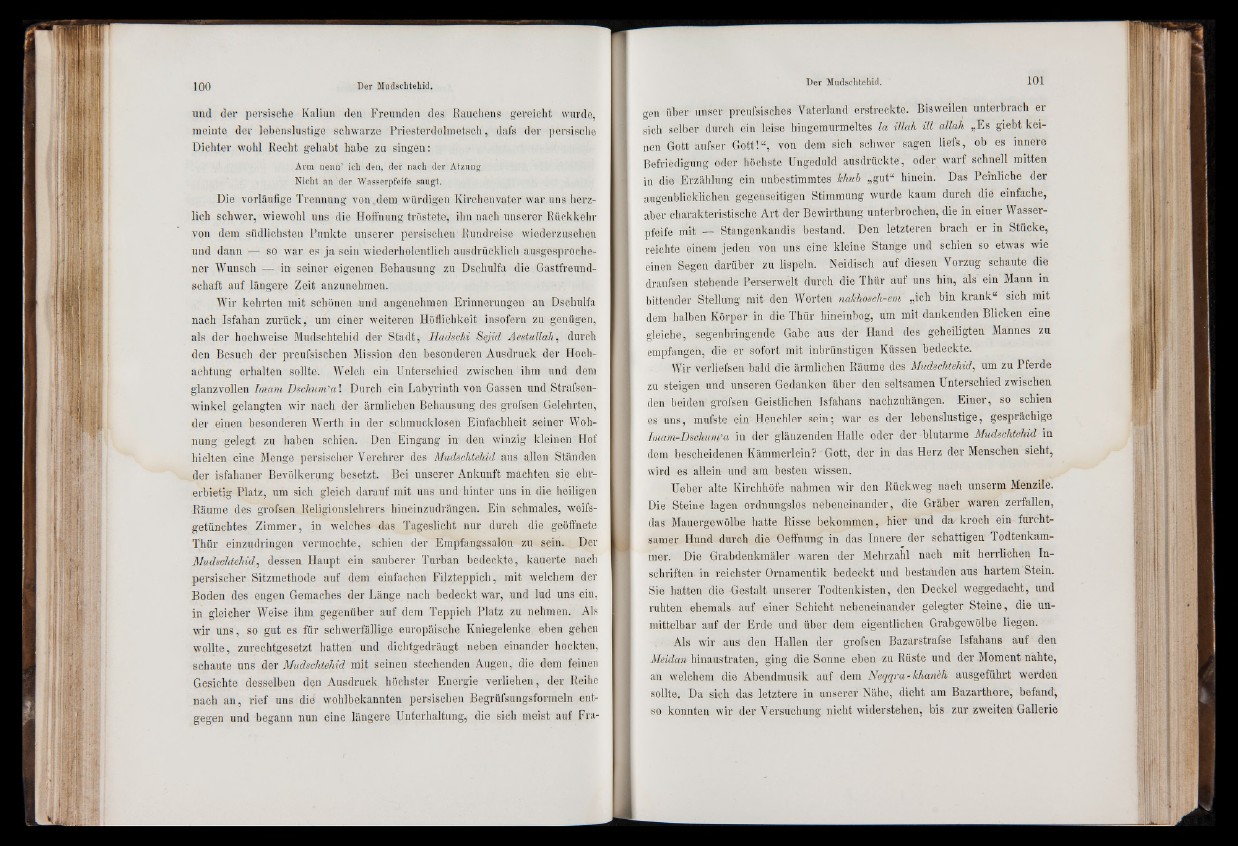
und der persische Kaliun den Freunden des Rauchens gereicht wurde,
meinte der lebenslustige schwarze Priesterdolmetsch, dafs der persische
Dichter wohl Recht gehabt habe zu singen:
Arm nenn’ ich den, der nach der Atzung,
Nicht an der Wasserpfeife sangt.
Die vorläufige Trennung von .dem würdigen Kirchenvater war uns herzlich
schwer, wiewohl uns die Hoffnung tröstete, ihn nach unserer Rückkehr
von dem südlichsten Punkte unserer persischen Rundreise wiederzusehen
und dann — so war es ja sein wiederholentlich ausdrücklich ausgesprochener
Wunsch — in seiner eigenen Behausung zu Dschulfa die Gastfreundschaft
auf längere Zeit anzunehmen.
Wir kehrten mit schönen und angenehmen Erinnerungen an Dschulfa
nach Isfahan zurück, um einer weiteren Höflichkeit insofern zu genügen,
als der hochweise Mudschtehid der Stadt, Hadschi Sejid Aestullah, durch
den Besuch der preufsischen Mission ,den besonderen Ausdruck der Hochachtung
erhalten sollte. Welch ein Unterschied zwischen ihm und dem
glanzvollen Imam Dschum'al Durch ein Labyrinth von Gassen und Strafsen-
winkel gelangten wir nach der ärmlichen Behausung des grofsen Gelehrten,
der einen besondereil Werth in der schmucklosen Einfachheit seiner Wohnung
gelegt zu haben schien. Den Eingang in den winzig kleinen Hof
hielten eine Menge persischer Verehrer des Mudschtehid aus allen Ständen
der isfahaner Bevölkerung besetzt. Bei unserer Ankunft machten sie ehrerbietig
Platz, um sich gleich darauf mit uns und hinter uns in die heiligen
Räume des grofsen Religionslehrers hineinzudrängen. Ein schmales, weifsgetünchtes
Zimmer, in welches das Tageslicht nur durch die geöffnete
Thür einzudringen vermochte, schien der Empfangssalon zu sein. Der
Mudschtehid, dessen Haupt ein sauberer Turban bedeckte, kauerte nach
persischer Sitzmethode auf dem einfachen Filzteppich, mit welchem der
Boden des engen Gemaches der Länge nach bedeckt war, und lud uns ein,
in gleicher Weise ihm gegenüber auf dem Teppich Platz zu nehmen. Als
wir uns, so gut es für schwerfällige europäische Kniegelenke, eben gehen
wollte, zurechtgesetzt hatten und dichtgedrängt neben einander hockten,
schaute uns der Mudschtehid mit seinen stechenden Augen, die dem feinen
Gesichte desselben den Ausdruck höchster Energie verliehen, der Reihe
nach an , rief uns die' wohlbekannten persischen Begrüfsungsformeln entgegen
und begann nun eine längere Unterhaltung, die sich meist auf Fragen
über unser preufsisches Vaterland erstreckte. Bisweilen unterbrach er
sich selber durch ein leise bingemurmeltes la illah Ul' allah „Es giebt keinen
Gott aufser Gott!“, von dem sich schwer sagen liefs, ob es innere
Befriedigung oder höchste Ungeduld ausdrückte', oder warf schnell mitten
in die Erzählung ein unbestimmtes khub „gut“ hinein. Das Peinliche der
augenblicklichen gegenseitigen Stimmung wurde kaum durch die einfache,
aber charakteristische Art der Bewirthung unterbrochen, die in einer Wasserpfeife
mit — Stangenkandis bestand. Den letzteren brach er in Stücke,
reichte einem jeden von uns eine kleine Stange und schien so etwas wie
einen Segen darüber zu lispeln. Neidisch auf diesen Vorzug schaute die
draufsen stehende P-erserwelt durch die Thür auf uns hin, als ein Mann in
bittender Stellung mit den Worten nakhosch-em „ich bin krank“ sich mit
dem halben Körper in die Thür hineinbog, um mit dankenden Blicken eine
gleiche, segenbringende Gabe aus der Hand des geheiligten Mannes zu
empfangen, die er sofort mit inbrünstigen Küssen bedeckte.
Wir verliefsen-bald die ärmlichen Räume des Mudschtehid, um zu Pferde
zu steigen und unseren Gedanken über den seltsamen Unterschied zwischen
den beiden1 grofsen Geistlichen Isfahans nachzuhängen. Einer, so schien
esnms, mufste ein Heuchler sein; war es der lebenslustige, gesprächige
Imam-Dschunfa in der glänzenden Halle oder der blutarme Mudschtehid in
dem bescheidenen Kämmerlein? Gott, der in das Herz der Menschen sieht,
wird es allein und am besten wissen.
Ueber alte Kirchhöfe nahmen wir den Rückweg nach unserm Menzile.
Die Steine lagen ordnungslos nebeneinander, die Gräber waren zerfallen,
das Mauergewölbe hatte Risse bekommen, hier und da^kroch ein furchtsamer
Hund durch die Oeffnung in das Innere der schattigen Todtenkam-
mer. Die Grabdenkmäler .waren der Mehrzahl nach mit herrlichen Inschriften
in reichster Ornamentik bedeckt und bestanden aus hartem Stein.
Sie hatten die -Gestalt unserer Todtenkisten, den Deckel weggedacht, und
ruhten ehemals auf einer Sehicht nebeneinander gelegter Steine, die unmittelbar
auf der Erde und über dem eigentlichen Grabgewölbe liegen.
Als wir aus den Hallen der grofsen Bazarstrafse Isfahans auf den
Meidari hinaustraten, ging die Sonne eben zu Rüste und der Moment nähte,
an welchem die Abendmusik auf dem Neqqra - khaneh ausgeführt werden
sollte. Da sich das letztere in unserer Nähe, dicht am Bazarthore, befand,
so konnten wir der Versuchung nicht widerstehen, bis zur zweiten' Gallerie