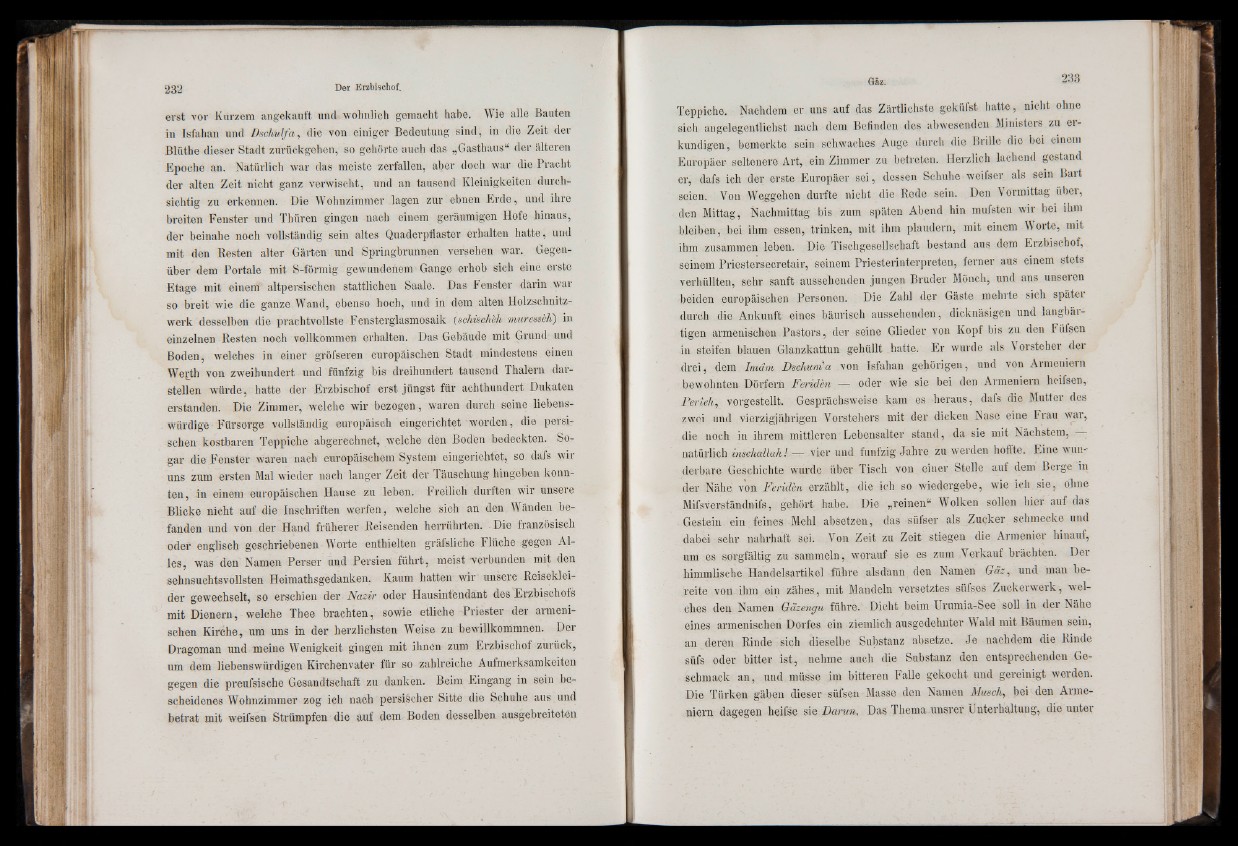
erst vor Kurzem angekauft und wohnlich gemacht habe. Wie alle Bauten
in Isfahan und Dscliulfa, die von einiger Bedeutung sind, in die Zeit der
Blüthe dieser Stadt zurückgehen, so gehörte auch das „Gasthaus“ der älteren
Epoche an. Natürlich war das meiste zerfallen, aber doch war die Pracht
der alten Zeit nicht ganz verwischt, und an tausend Kleinigkeiten durchsichtig
zu erkennen. Die Wohnzimmer lagen zur ebnen E rd e , und ihre
breiten Fenster und Thüren gingen nach einem geräumigen Hofe hinaus,
der beinahe noch vollständig sein altes Quaderpflaster erhalten hatte, und
mit den Resten alter Gärten und Springbrunnen versehen war. Gegenüber
dem Portale mit S-förmig gewundenem Gange erhob sich eine erste
Etage mit einem altpersischen stattlichen Saale. Das Fenster darin war
so breit wie die ganze Wand, ebenso hoch, und in dem alten Holzschnitzwerk
desselben die prachtvollste Fensterglasmosaik (schischeh muresseh) in
einzelnen Resten noch vollkommen erhalten. Das Gebäude mit Grund und
Boden, welches in einer gröfseren europäischen Stadt mindestens einen
Werth von zweihundert und fünfzig bis dreihundert tausend Thalern darstellen
würde, hatte der Erzbischof erst jüngst für achthundert Dukaten
erstanden. Die Zimmer, welche wir bezogen, waren durch seine liebenswürdige
Fürsorge vollständig europäisch eingerichtet worden, die persischen
kostbaren Teppiche abgerechnet, welche den Boden bedeckten. Sogar
die Fenster waren nach europäischem System eingerichtet, so dafs wir
uns zum ersten Mal wieder nach langer Zeit der Täuschung hingeben konnten,
in einem europäischen Hause zu leben. Freilich durften wir unsere
Blicke nicht auf die Inschriften werfen, welche sich an den Wänden befanden
und von der Hand früherer Reisenden herrührten. Die französisch
oder englisch geschriebenen Worte enthielten gräfsliche Flüche gegen Alles,
was den Namen Perser und Persien führt, meist verbunden mit den
sehnsuchtsvollsten Heimathsgedanken. Kaum hatten wir unsere Reisekleider
gewechselt, so erschien der Nazir oder Hausintendant des Erzbischofs
mit Dienern, welche Thee brachten, sowie etliche Priester der armenischen
Kirche, um uns in der herzlichsten Weise zu bewillkommnen. Der
Dragoman und meine Wenigkeit gingen mit ihnen zum Erzbischof zurück,
um dem liebenswürdigen Kirchenvater für so zahlreiche Aufmerksamkeiten
gegen die preufsische Gesandtschaft zu danken. Beim Eingang in sein bescheidenes
Wohnzimmer zog ich nach persischer Sitte die Schuhe aus und
betrat mit weifsen Strümpfen die auf dem Boden desselben ausgebreiteten
Teppiche. Nachdem er uns auf das Zärtlichste geküfst hatte, nicht ohne
sich angelegentlichst nach dem Befinden des abwesenden Ministers zu erkundigen,
bemerkte sein schwaches Auge durch die Brille die bei einem
Europäer seltenere Art, ein Zimmer zu betreten. Herzlich lachend gestand
er, dafs ich der erste Europäer sei, dessen Schuhe weißer als sein Bart
seien. Von Weggehen durfte nicht die Rede sein. Den Vormittag übei,
den Mittag, Nachmittag bis zum späten Abend hin mufsten wir bei ihm
bleiben, bei ihm essen, trinken, mit ihm plaudern, mit einem Worte, mit
ihm zusammen leben. Die Tischgesellschaft bestand aus dem Erzbischof,
seinem Priestersecretair, seinem Priesterinterpreten, ferner aus einem stets
verhüllten, sehr sanft aussehenden jungen Bruder Mönch, und ans unseren
beiden europäischen Personen. Die Zahl der Gäste mehrte sich spätei
durch die Ankunft eines bäurisch aussehenden, dicknäsigen und langbärtigen
armenischen Pastors, der seine Glieder von Kopf bis zu den Füfsen
in steifen blauen Glanzkattun gehüllt hatte. Er wurde als Vorsteher der
drei, dem Imam Dschuni'a von Isfahan gehörigen, und von Armeniern
bewohnten Dörfern Feriden —r oder wie sie bei den Armeniern heifsen,
Perieh, vorgestellt. Gesprächsweise kam es heraus, dafs die Mutter des
zwei und vierzigjährigen Vorstehers mit der dicken Nase eine Frau war,
die noch in ihrem mittleren Lebensalter stand, da sie mit Nächstem, -
natürlich insehallali !■ — vier und fünfzig Jahre zu werden hoffte. Eine wunderbare
Geschichte wurde über Tisch von eiuer Stelle auf dem Berge in
der Nähe von Feriden erzählt, die ich so wiedergebe, wie ich sie, ohne
Mißverständnifs, gehört habe. Die „reinen“ Wolken sollen hier auf das
Gestein ein feines Mehl absetzen, das süßer als Zucker schmecke und
dabei sehr nahrhaft sei. Von Zeit zu Zeit stiegen die Armenier hinauf,
um es sorgfältig zu sammeln, worauf sie es zum Verkauf brächten. Der
himmlische Handelsartikel führe alsdann den Namen Gäz, und man bereite
von ihm ein zähes, mit Mandeln versetztes süfses Zuckerwerk, welches
den Namen Gäzengu führe.' Dicht beim Urumia-See soll in der Nähe
eines armenischen Dorfes ein ziemlich ausgedehnter Wald mit Bäumen sein,
an deren Rinde sich dieselbe Substanz absetze. Je nachdem die Rinde
süß oder bitter ist, nehme auch die Substanz den entsprechenden Geschmack
an, und müsse im bitteren Falle gekocht und gereinigt werden.
Die Türken gäben dieser süßen Masse den Namen Musch, bei den Armeniern
dagegen heifse sie Dänin, Das Thema unsrer Unterhaltung, die unter