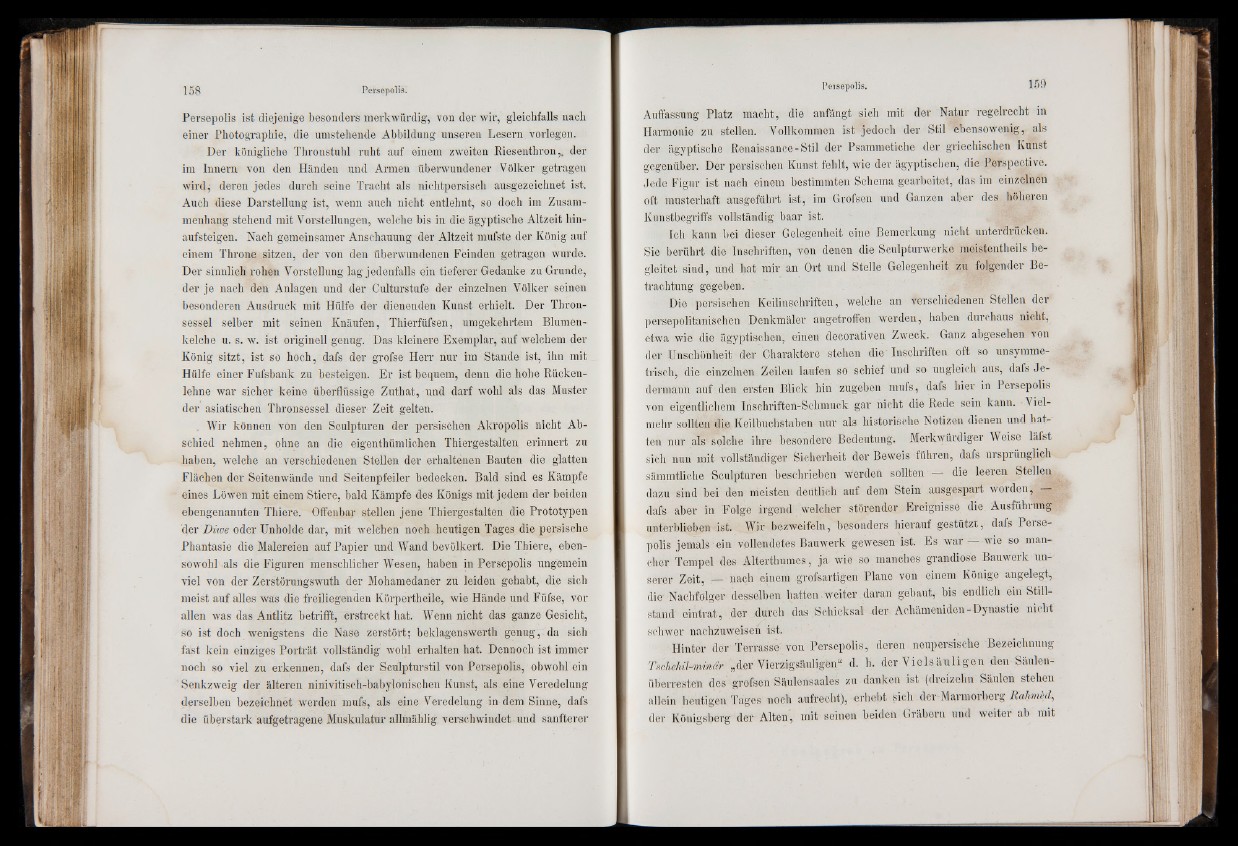
Persepolis ist diejenige besonders merkwürdig, von der wir, gleichfalls nach
einer Photographie, die umstehende Abbildung unseren Lesern vorlegen.
Der königliche Thronstuhl ruht auf einem zweiten Riesenthron,, der
im Innern von den Händen und Armen überwundener Völker getragen
wird, deren jedes durch seine Tracht als nichtpersisch ausgezeichnet ist.
Auch diese Darstellung ist, wenn auch nicht entlehnt, so doch im Zusammenhang
stehend mit Vorstellungen, welche bis in die ägyptische Altzeit hinaufsteigen.
Nach gemeinsamer Anschauung der Altzeit mufste der König auf
einem Throne sitzen, der von den überwundenen Feinden getragen wurde.
Der sinnlich rohen Vorstellung lag jedenfalls ein tieferer Gedanke zu Grunde,
der je nach den Anlagen und der Culturstufe der einzelnen Völker seinen
besonderen Ausdruck mit Hülfe der dienenden Kunst erhielt. Der Thron-
■
sessel selber mit seinen Knäufen, Thierfüfsen, umgekehrtem Blumenkelche
u. s. w. ist originell genug. Das kleinere Exemplar, auf welchem der
König sitzt, ist so hoch, dafs der grofse Herr nur im Stande ist, ihn mit
Hülfe einer Fufsbank zu besteigen. E r ist bequem, denn die hohe Rückenlehne
war sicher keine überflüssige Zuthat, und darf wohl als das Muster
der asiatischen Thronsessel dieser Zeit gelten.
. Wir können von den Sculpturen der persischen Akropolis nicht Abschied
nehmen, ohne an die eigenthümlichen Thiergestalten erinnert zu
haben, welche an verschiedenen Stellen der erhaltenen Bauten die glatten
Flächen der Seitenwände und Seitenpfeiler bedecken. Bald sind es Kämpfe
eines Löwen mit einem Stiere, bald Kämpfe des Königs mit jedem der beiden
ebengenannten Thiere. Offenbar stellen jene Thiergestalten die Prototypen
der D iw eoder Unholde dar, mit welchen noch heutigen Tages die persische
Phantasie die Malereien auf Papier und Wand bevölkert. Die Thiere, ebensowohl
als die Figuren menschlicher Wesen, haben in Persepolis ungemein
viel von der Zerstörungswuth der Mohamedaner zu leiden gehabt, die sich
meist auf alles was die freiliegenden Körpertheile, wie Hände und Füfse, vor
allen was das Antlitz betrifft, erstreckt hat. Wenn nicht das ganze Gesicht,
so ist doch wenigstens die Nase zerstört; beklagenswert genug, da sich
fast kein einziges Porträt vollständig wohl erhalten hat. Dennoch ist immer
noch so viel zu erkennen, dafs der Sculpturstil von Persepolis, obwohl ein
Senkzweig der älteren ninivitisch-babylonischen Kunst, als eine Veredelung
derselben bezeichnet werden mufs, als eine Veredelung in dem Sinne, dafs
die überstark aufgetragene Muskulatur allmählig verschwindet und sanfterer
Auffassung Platz macht, die anfängt sich mit der Natur regelrecht in
Harmonie zu stellen. Vollkommen ist jedoch der Stil ebensowenig, als
der ägyptische Renaissance-Stil der Psammetiche der griechischen Kunst
gegenüber. Der persischen Kunst fehlt, wie der ägyptischen, die Perspective.
Jede Figur ist nach einem bestimmten Schema gearbeitet, das im einzelnen
oft musterhaft ausgeführt ist, im Grofsen und Ganzen aber des. höheren
Kunstbegriffs vollständig baar ist.
Ich kann bei dieser Gelegenheit eine Bemerkung nicht unterdrücken.
Sie berührt die Inschriften, von denen die Sculpturwerke meistenteils begleitet
sind, und hat mir an Ort und Stelle Gelegenheit zu folgender Betrachtung
gegeben.
Die persischen Keilinschriften, welche an verschiedenen Stellen der
persepolitanischen Denkmäler angetroffen werden, haben durchaus nicht,
etwa wie die ägyptischen, einen decorativen Zweck. Ganz, abgesehen von
der IJnschöhheit • der Charaktere -stehen die' Inschriften oft so unsymmetrisch,
die einzelnen Zeilen laufen sö schief und so ungleich aus, dafs J e dermann
auf den ersten Blick hin zugeben mufs, dafs hier in Persepolis
von eigentlichem Inschrifteü-Schmuck gar nicht die Rede sein kann. \ iel-
mehr sollten die Keilbuchstaben nur als historische Notizen dienen und hatten
nur als solche ihre besondere Bedeutung. Merkwürdiger Weise läfst
sich nun mit vollständiger Sicherheit der Beweis führen, dafs ursprünglich
sämmtliehe Sculpturen beschrieben werden sollten ■ — die leeren Stellen
dazu sind bei den meisten deutlich auf dem Stein ausgespart worden,,
dafs aber in Folge irgend welcher störender Ereignisse die Ausführung
unterblieben ist. Wir bezweifeln, besonders hierauf gestützt, dafs Persepolis
jemals ein vollendetes Bauwerk gewesen ist. Es war -wie. so mancher
Tempel des Alterthumes, ja wie so manches grandiose Bauwerk unserer
Zeit, nach ejnem grofsartigen Plane von einem Könige' angelegt,
die' Nachfolger desselben hatten-weiter daran gebaut,- bis endlich ein Stdl-
stand eintrat, der durch das .Schicksal der-Achämeniden-Dynastie nicht
schwer nachiuweisen ist.
Hinter der Terrasse: von Persepolis, deren neupersische Bezeichnung
T s ch e h il-m in ä r „der Vierzigsäuligen“ d. h. der V i e l s ä u l i g e n den Säulenüberresten
des: grofsen Sänlensaales zu danken ist (dreizehn Säulen stehen
allein heutigen Tages noch aufrecht), erhebt sich der-Marmorberg Ralvmed,
der Königsberg der Alten', mit seinen beiden Gräbern und weiter ab mit