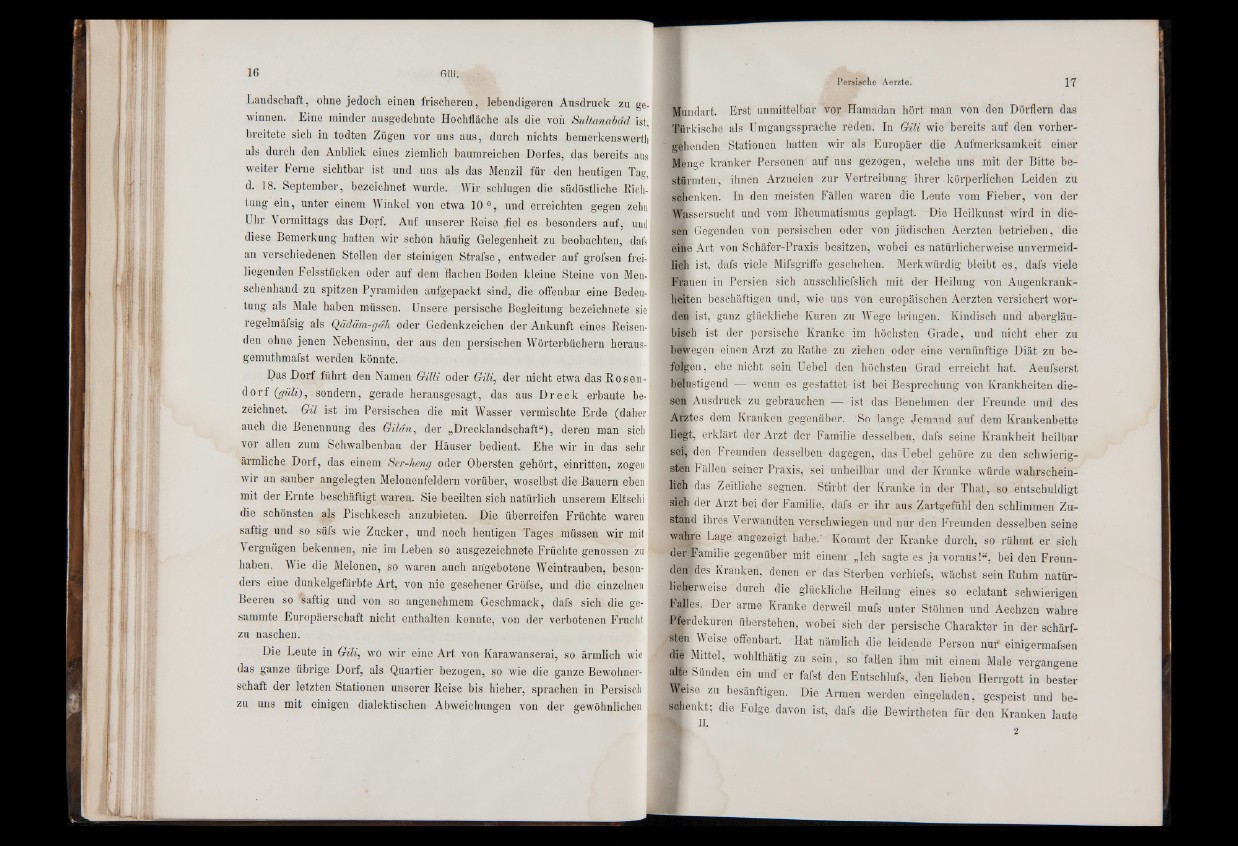
Landschaft, ohne jedoch einen frischeren, lebendigeren Ausdruck zu gewinnen.
Eine minder ausgedehnte Hochfläche als die von Sultanabad ist
breitete sich in todten Zügen vor uns aus, durch nichts bemerkenswerth
als durch den Anblick eines ziemlich baumreichen Dorfes, das bereits aus
weiter Ferne sichtbar ist und uns als das Menzil für den heutigen Tag,
d. 18. September, bezeichnet wurde. Wir schlugen die südöstliche Richtung
ein, unter einem Winkel von etwa 1 0 ° , und erreichten gegen zehn
Uhr Vormittags das Dorf. Auf unserer Reise fiel es besonders auf, und
diese Bemerkung hatten wir schon häufig Gelegenheit zu beobachten, dafsj
an verschiedenen Stellen der steinigen Strafse, entweder auf grofsen freiliegenden
Felsstücken oder auf dem flachen Boden kleine Steine von Menschenhand
zu spitzen Pyramiden aufgepackt sind, die offenbar eine Bedeutung
als Male haben müssen. Unsere persische Begleitung bezeichnete sie!
regelmäfsig als Qädäm-gdh oder Gedenkzeichen der Ankunft eines Reisenden
ohne jenen Nebensinn, der aus den persischen Wörterbüchern heraus-
gemuthmafst werden könnte.
Das Dorf führt den Namen Gilli oder Gili, der nicht etwa das R o s e n d
o r f (güli), sondern, gerade herausgesagt, das aus D r e c k erbaute bezeichnet.
Gil ist im Persischen die mit Wasser vermischte Erde (daher j
auch die Benennung des Gildn, der „Drecklandschaft“), deren man sich
vor allen zum Schwalbenbau der Häuser bedient. Ehe wir in das sehr
ärmliche Dorf, das einem Ser-heng oder Obersten gehört, einritten, zogen
wir an sauber angelegten Melonenfeldern vorüber, woselbst die Bauern eben I
mit der Ernte beschäftigt waren. Sie beeilten sich natürlich unserem Eltschi j
die schönsten als Pischkesch anzubieten. Die überreifen Früchte waren I
saftig und so süfs wie Zucker, und noch heutigen Tages müssen wir mitl
Vergnügen bekennen, nie im Leben so ausgezeichnete Früchte genossen zu j
haben. Wie die Melonen, so waren auch angebotene Weintrauben, besonders
eine dunkelgefärbte Art, von nie gesehener Gröfse, und die einzelnen j
Beeren so ^saftig und von so angenehmem Geschmack, dafs sich die ge-1
sammte Enropäerschaft nicht enthalten konnte, von der verbotenen Frucht I
zu naschen.
Die Leute in Gili, wo wir eine Art von Karawanserai, so ärmlich wie I
das ganze übrige Dorf, als Quartier bezogen, so wie die ganze Bewohner- -
schaft der letzten Stationen unserer Reise bis hieher, sprachen in Persisch j
zu uns mit einigen dialektischen Abweichungen von der gewöhnlichen ]
Persische Aerzte. 17
Mundart. Erst unmittelbar vor Hamadan hört man von den Dörflern das
Türkische als Umgangssprache reden. In Gili wie bereits auf den vorhergehenden
Stationen hatten wir als Europäer die Aufmerksamkeit einer
Menge kranker Personen auf uns gezogen, welche uns mit der Bitte bestürmten,
ihnen Arzneien zur Vertreibung ihrer körperlichen Leiden zu
schenken. In den meisten Fällen waren die Leute vom Fieber, von der
Wassersucht und vom Rheumatismus geplagt. Die Heilkunst wird in diesen
Gegenden von persischen oder von jüdischen Aerzten betrieben, die
einb Art von Schäfer-Praxis besitzen, wobei es natürlicherweise unvermeidlich
ist, dafs viele Mifsgriffe geschehen. Merkwürdig bleibt es, dafs viele
Frauen in Persien sich ausschliefslich mit der Heilung von Augenkrankheiten
beschäftigen und, wie uns von europäischen Aerzten versichert worden
ist, ganz glückliche Kuren zu Wege bringen. Kindisch und abergläubisch
ist der persische Kranke im höchsten Grade, und nicht eher zu
bewegen einen Arzt zu Rathe zu ziehen oder eine vernünftige Diät zu befolgen,
ehe nicht sein Uebel den höchsten Grad erreicht hat. Aeufserst
belustigend —■ wenn es gestattet ist bei Besprechung von Krankheiten die-
seni Ausdruck zu gebrauchen — ist das Benehmen der Freunde und des
Arztes dem Kranken gegenüber. So lange Jemand auf dem Krankenbette
liegt, erklärt der Arzt der Familie desselben, dafs seine Krankheit heilbar
sei,1' den Freunden desselben dagegen, das Uebel gehöre zu den schwierigsten
Fällen seiner Praxis, sei unheilbar und der Kranke würde, wahrscheinlich
das Zeitliche segnen. Stirbt der Kranke in der That, so entschuldigt
sieh der Arzt bei der Familie, dafs er ihr aus Zartgefühl den schlimmen Zu-
ständ ihres Verwandten verschwiegen und nur den Freunden desselben seine
Lage angezeigt habe.' Kommt der Kranke durch, so rühmt er sich
denFamilie gegenüber mit einem „Ich sagte es ja voraus!“, bei den Freunden
des Kranken, denen er das Sterben verhiefs, wächst sein Ruhm natürlicherweise
durch die glückliche Heilung eines so «clatant schwierigen
j^Bes; Der arme Kranke dörweil mufs unter Stöhnen und Aechzen wahre
Pferdeküren überstehen, wobei sich der persische Charakter in der schärf-
6t|n Weise offenbart. Hat nämlich die leidende Person n u f einigermafsen
die Mittel, wohlthätig zu sein, so faRen ihm mit einem Male vergangene
alte Sünden ein und er fafst den Entschlufs, den lieben Herrgott in bester
* i s e zu besänftigen. Die Armen werden eingeladen, gespeist und beschenkt;
die Folge davon ist, dafs die Bewirtheten für den Kranken laute
L ' 2