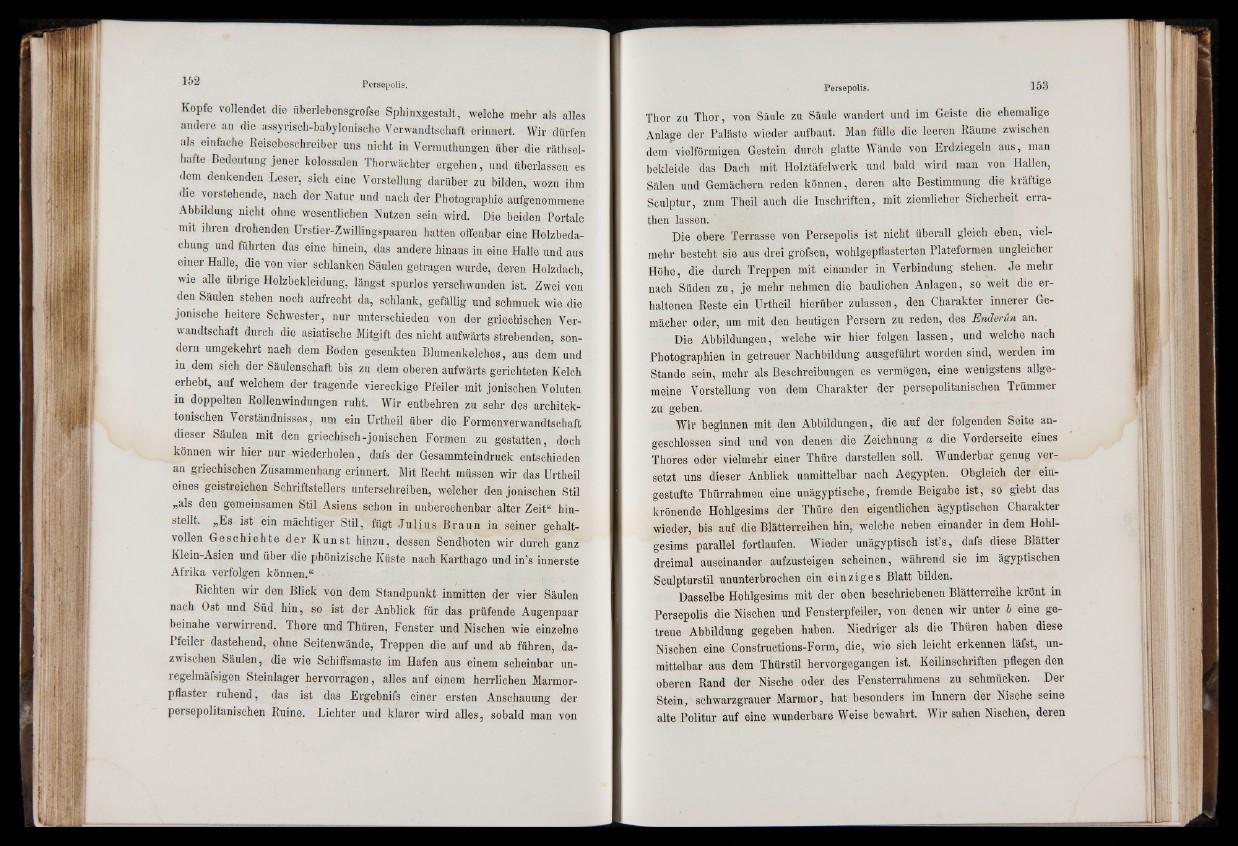
Kopfe vollendet die überlebensgrofse Sphinxgestalt, welche mehr als alles
andere an die assyrisch-babylonische Verwandtschaft erinnert. Wir dürfen
als einfache Reisebeschreiber uns nicht in Vermuthungen über- die r ä ts e lhafte
Bedeutung jener kolossalen Thorwächter ergehen, und überlassen es
dem denkenden Leser, sich eine Vorstellung darüber zu bilden, wozu ihm
die vorstehende, nach der Natur und nach der Photographie aufgenommene
Abbildung nicht ohne wesentlichen Nutzen sein wird. Die beiden Portale
mit ihren drohenden Ürstier-Zwillingspaaren hatten offenbar eine Holzbedachung
und führten das eine hinein, das andere hinaus in eine Halle und ans
einer Halle, die von vier schlanken Säulen getragen wurde, deren Holzdach,
wie alle übrige Holzbekleidung, längst spurlos verschwunden ist. Zwei von
den Säulen stehen noch aufrecht da, schlank, gefällig undschmuck wie die
jonische heitere Schwester, nur unterschieden von der griechischen Verwandtschaft
durch die asiatische Mitgift des nicht aufwärts strebenden, sondern
umgekehrt nach dem Boden gesenkten Blumenkelches, aus dem und
in dem sich der Säulenschaft bis zu dem oberen aufwärts gerichteten Kelch
erhebt, auf welchem der tragende viereckige Pfeiler mit jonischen. Voluten
in doppelten Bollenwindungen ruht. Wir entbehren zu sehr des architektonischen
Verständnisses, um ein Urtheil über die Formenverwandtschaft
dieser Säulen mit den griechisch-jonischen Formen zu gestatten, doch
können wir hier nur wiederholen , dafs der Gesammteindruck entschieden
an griechischen Zusammenhang erinnert. Mit Recht müssen wir das Urtheil
eines geistreichen Schriftstellers unterschreiben, welcher den jonischen Stil
„als den gemeinsamen Stil Asiens schon in unberechenbar alter Zeit“ hinstellt.
„Es ist ein mächtiger Stil, fügt J u l i u s B r a u n in seiner gehaltvollen
Ge sc hi c h t e der Kun s t hinzu, dessen Sendboten wir durch ganz
Klein-Asien und über die phönizische Küste nach Karthago und in’s innerste
Afrika verfolgen können.“
Richten wir den Blick von dem Standpunkt inmitten der vier Säulen
nach Ost und Süd hin, so ist der Anblick für das prüfende Augenpaar
beinahe verwirrend. Thore und Thüren, Fenster und Nischen wie einzelne
Pfeiler dastehend, ohne Seitenwände, Treppen die auf und ab führen, dazwischen
Säulen, die wie Schiffsmaste im Hafen aus einem scheinbar un-
regelmäfsigen Steinlager hervorragen, alles auf einem herrlichen Marmorpflaster
ruhend, das ist das Ergebnifs einer ersten Anschauung der
persepolitanischen Ruine. Lichter und klarer wird alles, sobald man von
Thor zu Thor , von Säule zu Säule wandert und im Geiste die ehemalige
Anlage der Paläste wieder aufbaut. Man fülle die leeren Räume zwischen
dem vielförmigen Gestein durch glatte Wände von Erdziegeln aus, man
bekleide das Dach mit Holztäfelwerk und bald wird man von Hallen,
Sälen und Gemächern reden können, deren alte Bestimmung die kräftige
Sculptur, znm Theil auch die Inschriften, mit ziemlicher Sicherheit erra-
then lassen.
Die obere Terrasse von Persepolis ist nicht überall gleich eben, vielmehr
besteht sie aus drei grofsen, wohlgepflasterten Plateformen ungleicher
Höhe, die durch Treppen mit einander in Verbindung stehen. Je mehr
nach Süden zu, je mehr nehmen die baulichen Anlagen, so weit die erhaltenen
Reste ein Urtheil hierüber zulassen, den Charakter innerer Gemächer
oder, um mit den heutigen Persern zu reden, des Enderun an.
Die Abbildungen, welche wir hier folgen lassen, und welche nach
Photographien in getreuer Nachbildung ausgeführt worden sind, werden im
Stande sein, mehr als Beschreibungen es vermögen, eine wenigstens allgemeine
Vorstellung von dem Charakter der persepolitanischen Trümmer
zu geben.
Wir beginnen mit den Abbildungen die auf der folgenden Seite angeschlossen
sind und von denen die Zeichnung a die Vorderseite eines
Thores oder vielmehr einer Thüre darstellen soll. Wunderbar genug versetzt
uns dieser Anblick unmittelbar nach Aegypten. Obgleich der eingestufte
Thürrahmen eine unägyptische, fremde Beigabe is t, so giebt das
krönende Hohlgesims der Thüre den eigentlichen ägyptischen Charakter
wieder, bis auf die Blätterreihen hin, welche neben einander in dem Hohlgesims
p a raM fortlaufen. Wieder unägyptisch ist’s , dafs diese Blätter
dreimal auseinander aufzusteigen scheinen, während sie im ägyptischen
Sculpturstil ununterbrochen ein e inziges Blatt bilden.
Dasselbe Hohlgesims mit der oben beschriebenen Blätterreihe krönt in
Persepolis die Nischen und Fensterpfeiler, von denen wir unter b eine getreue
Abbildung gegeben haben. Niedriger als die Thüren haben diese
Nischen eine Construetions-Form, die, wie sich leicht erkennen läfst, unmittelbar
aus dem Thürstil hervorgegangen ist. Keilinschriften pflegen den
oberen Rand der Nische oder des Fensterrahmens zu schmücken. Der
Stein/schwarzgrauer Marmor, hat besonders im Innern der Nische seine
alte Politur auf eine wunderbare Weise bewahrt. Wir sahen Nischen, deren