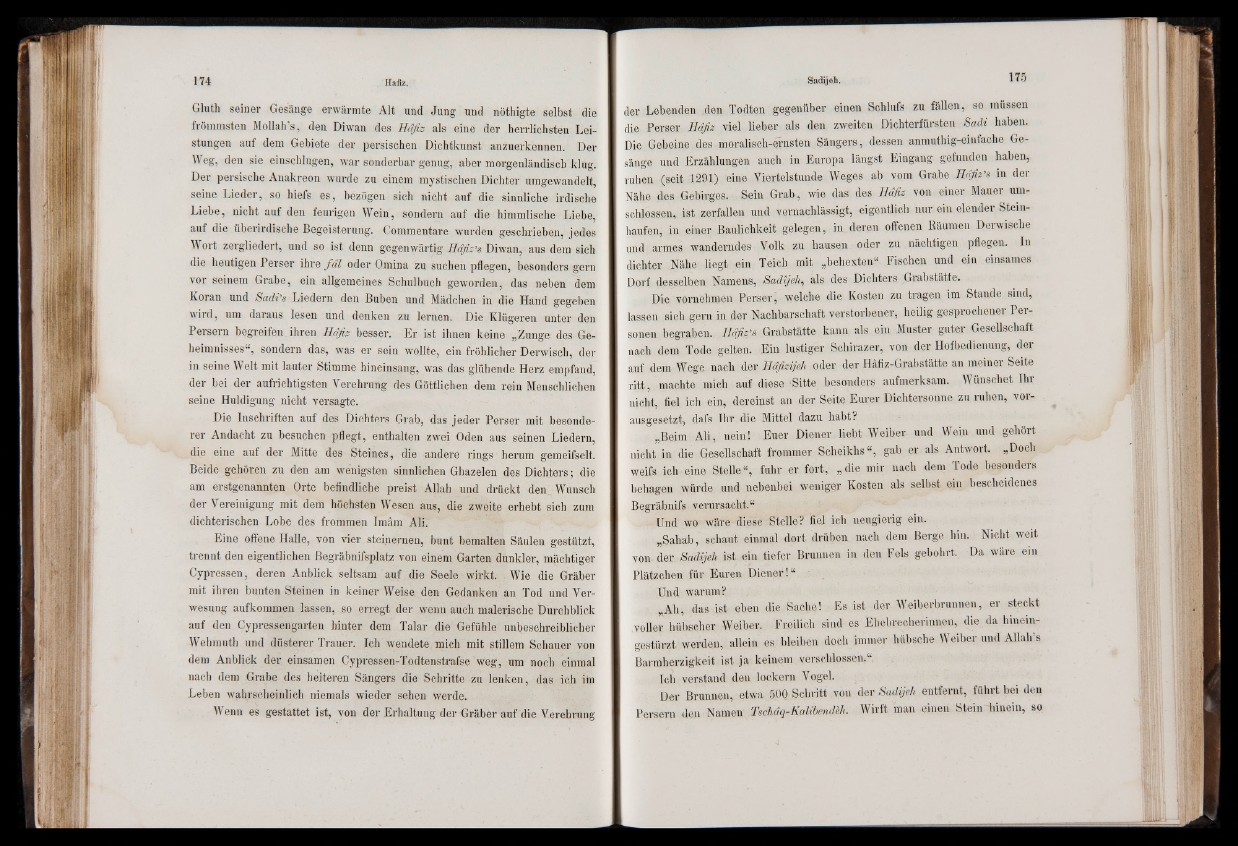
Ghith seiner Gesänge erwärmte Alt und Jung und nöthigte selbst die
frömmsten Mollah’s , den Diwan des Hctfis als eine der herrlichsten Leistungen
auf dem Gebiete der persischen Dichtkunst anzuerkennen. Der
Weg, den sie einschlugen, war sonderbar genug, aber morgenländisch klug.
Der persische Anakreon wurde zu einem mystischen Dichter umgewandelt,
seine Lieder, so hiefs e s , bezögen sich nicht auf die sinnliche irdische
Liebe, nicht auf den feurigen Wein, sondern auf die himmlische Liebe,
auf die überirdische Begeisterung. Commentare wurden geschrieben, jedes
Wort zergliedert, und so ist denn gegenwärtig Hdfiz's Diwan, aus dem sich
die heutigen Perser ihre f ä l oder Omina zu suchen pflegen, besonders gern
vor seinem Grabe, ein allgemeines Schulbuch geworden, das neben dem
Koran und Sadds Liedern den Buben und Mädchen in die Hand gegeben
wriid , um daraus lesen und denken zu lernen. Die Klügeren unter den
Persern begreifen ihren Hafiz besser. Er ist ihnen keine „Zunge des Geheimnisses“,
sondern das, was er sein wollte, ein fröhlicher Derwisch, der
in seine Welt mit lauter Stimme hineinsang, was das glühende Herz empfand,
der bei der aufrichtigsten Verehrung des Göttlichen dem rein Menschlichen
seine Huldigung nicht versagte.
Die Inschriften auf des Dichters Grab, das jeder Perser mit besonderer
Andacht zu besuchen pflegt, enthalten zwei Oden aus seinen Liedern,
die eine auf der Mitte des Steines, die andere rings herum gemeifselt.
Beide gehören zu den am wenigsten sinnlichen Ghazelen des Dichters; die
am erstgenannten Orte befindliche preist Allah und drückt den Wunsch
der Vereinigung mit dem höchsten Wesen aus, die zweite erhebt sich zum
dichterischen Lobe des frommen Imam Ali.
Eine offene Halle, von vier steinernen, bunt bemalten Säulen gestützt,
trennt den eigentlichen Begräbnifsplatz von einem Garten dunkler, mächtiger
Cypressen, deren Anblick seltsam auf die Seele wirkt. Wie die Gräber
mit ihren bunten Steinen in keiner Weise, den Gedanken an Tod und Verwesung
aufkommen lassen, so erregt der wenn auch malerische Durchblick
auf den Cypressengarten hinter dem Talar die Gefühle unbeschreiblicher
Webmuth und düsterer Trauer. Ich wendete mich mit stillem Schauer von
dem Anblick der einsamen Cypressen-Todtenstrafse weg, um noch einmal
nach dem Grabe des heiteren Sängers die Schritte zu lenken, das ich im
Leben wahrscheinlich niemals wieder sehen werde.
Wenn es gestattet ist, von der Erhaltung der Gräber auf die Verehrung
der Lebenden den Todten gegenüber einen Schlufs zu fällen, so müssen
die Perser Hafiz viel lieber als den zweiten Dichterfürsten Sadi haben.
Die Gebeine des moralisch-ernsten Sängers, dessen anmuthig-einfache Gesänge
und Erzählungen auch in Europa längst Eingang gefunden haben,
ruhen (seit 1291) eine Viertelstunde Weges ab vom Grabe Hdfiz’s in der
Nähe des Gebirges. Sein Grab, wie das des Hafiz von einer Mauer umschlossen,
ist zerfallen und vernachlässigt, eigentlich nur ein elender Steinhaufen,
in einer Baulichkeit gelegen, in deren offenen Räumen Derwische
und armes wanderndes Volk zu hausen oder zu nächtigen pflegen. In
dichter Nähe liegt ein Teich mit „behexten“ Fischen und ein einsames
Dorf desselben Namens, Sadijeh, als des Dichters Grabstätte.
Die vornehmen Perser, welche die Kosten zu tragen im Stande sind,
lassen sich gern in der Nachbarschaft verstorbener, heilig gesprochener Personen
begraben. Ildfifis Grabstätte kann als ein Muster guter Gesellschaft
nach dem Tode gelten. Ein lustiger Schirazer, von der Hofbedienung, der
auf dem Wege nach der Hdfizijeh oder der Häfiz-Grabstätte an meiner Seite
ritt, machte mich auf diese Sitte besonders aufmerksam. Wünschet Ihr
nicht, fiel ich ein, dereinst an d e r Seite Eurer Dichtersonne zu ruhen, vorausgesetzt,
dafs Ihr die Mittel dazu habt?
„Beim Ali, nein! Euer Diener liebt Weiber- und Wein und gehört
nicht in die Gesellschaft frommer Scheikhs“, gab er als Antwort. „Doch
weifs ich eine Stelle“, fuhr er fort, „die mir nach dem Tode besonders
behagen würde und nebenbei weniger Kosten als selbst ein bescheidenes
Begräbnifs verursacht.“
Und wo wäre diese Stelle? fiel ich neugierig ein.
.„Sahäb, schaut einmal dort drüben nach dem Berge hin. Nicht weit
von-der Sadijeh ist ein tiefer Brunnen in den Fels gebohrt. Da wäre ein
Plätzchen für Euren Diener!“
Und warum?
„Ah, das ist e b e n die Bache! Es ist der Weiberbrunnen, er steckt
voller hübscher Weiber. Freilich sind es Ehebrecherinnen, die da hineingestürzt
werden, allein es bleiben doch immer hübsche Weiber und Allairs
Barmherzigkeit ist ja keinem verschlossen.“
Ich verstand den lockern Vogel.
Der Brunnen, etwa 500 Schritt von der Sadijeh entfernt, führt bei den
Persern den Namen Tschdq-Kalibendéh. Wirft man einen Stein hinein, so