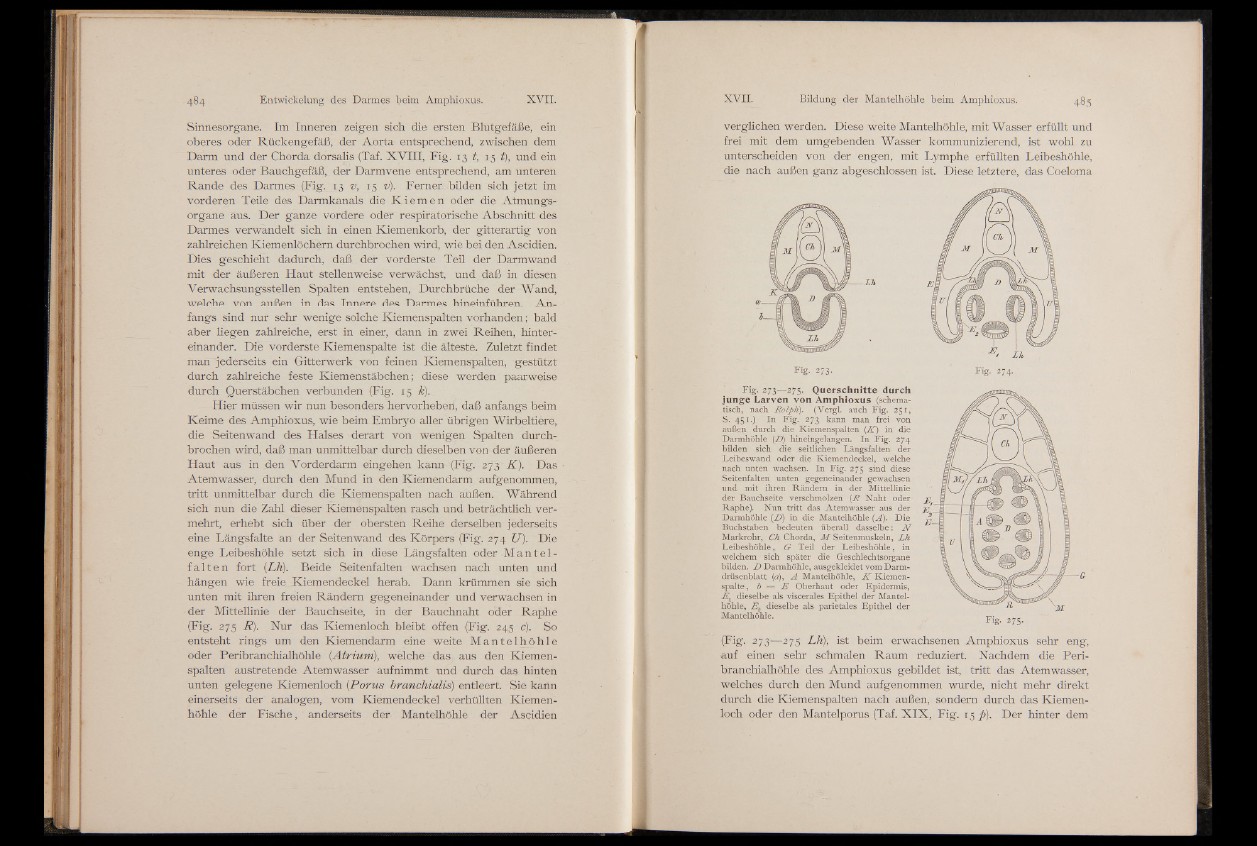
Sinnesorgane. Im Inneren zeigen sich die ersten Blutgefäße, ein
oberes oder Rückengefäß, der Aorta entsprechend, zwischen dem
Darm und der Chorda dorsalis (Taf. XVIII, Fig. 13 t, 15 t), und ein
unteres oder Bauchgefäß, der Darmvene entsprechend, am unteren
Rande des Darmes (Fig. 13 v, 15 v). Ferner, bilden sich jetzt im
vorderen Teile des Darmkanals die Ki emen oder die Atmungsorgane
aus. Der ganze vordere oder respiratorische Abschnitt des
Darmes verwandelt sich in einen Kiemenkorb, der gitterartig von
zahlreichen Kiemenlöchern durchbrochen wird, wie bei den Ascidien.
Dies geschieht dadurch, daß der vorderste Teil der Darmwand
mit der äußeren Haut stellenweise verwächst, und daß in diesen
Verwachsungsstellen Spalten entstehen, Durchbrüche der Wand,
welche von außen in das Innere des Darmes hineinführen. Anfangs
sind nur sehr wenige solche Klemenspalten vorhanden; bald
aber liegen zahlreiche, erst in einer, dann in zwei Reihen, hintereinander.
Die vorderste Kiemenspalte ist die älteste. Zuletzt findet
manTjederseits ein Gitterwerk von feinen Kiemenspalten, gestützt
durch zahlreiche feste Kiemenstäbchen; diese werden paarweise
durch Querstäbchen verbunden (Fig. 15 k).
Hier müssen wir nun besonders hervorhebeü, daß anfangs beim
Keime des Amphioxus, wie beim Embryo aller übrigen Wirbeltiere,
die Seitenwand des Halses derart von wenigen Spalten durchbrochen
wird, daß man unmittelbar durch dieselben von der äußeren
Haut aus in den Vorderdarm eingehen kann (Fig. 273 K). Das
Atemwasser, durch den Mund in den Kiemendarm aufgenommen,
tritt unmittelbar durch die Kiemenspalten nach außen. Während
sich nun die Zahl dieser Kiemenspalten rasch und beträchtlich vermehrt,
erhebt sich über der obersten Reihe derselben jederseits
eine Längsfalte an der Seiten wand des Körpers (Fig. 274 U). Die
enge Leibeshöhle setzt sich in diese Längsfalten oder Mant e l fal
t en fort (Lh). Beide Seitenfalten wachsen nach unten und
hängen wie freie Kiemendeckel herab. Dann krümmen sie sich
unten mit ihren freien Rändern gegeneinander und verwachsen in
der Mittellinie der Bauchseite, in der Bauchnaht oder Raphe
(Fig. 275 R). Nur das Kiemenloch bleibt offen (Fig. 245 c). So
entsteht rings um den Kiemendarm eine weite Mante lhöhle
oder Peribranchialhöhle (Atrium), welche das aus den Kiemenspalten
austretende Atemwasser aufnimmt und durch das hinten
unten gelegene Kiemenloch (Porus branchialis) entleert. Sie kann
einerseits der analogen, vom Kiemendeckel verhüllten Kiemenhöhle
der Fische, anderseits der Mantelhöhle der Ascidien
verglichen werden. Diese weite Mantelhöhle, mit Wasser erfüllt und
frei mit dem umgebenden Wasser kommunizierend, ist wohl zu
unterscheiden von der engen, mit Lymphe erfüllten Leibeshöhle,
die nach außen ganz abgeschlossen ist. Diese letztere, das Coeloma
Fig, 273— 275. Querschnitte durch
junge Larven von Amphioxus (Schema-
tisch, nach Rolfih). (Vergiß auch Fig. 251,
S. 451.) In Fig. 273 kann man frei von
außen durch die Kiemenspalten (ET) in die
Darmhöhle (D) hineingelangen. In Fig. 274
bilden sich die seitlichen Längsfalten der
Leibeswand oder die Kiemendeckel, welche
nach unten wachsen. In Fig. 275 sind diese
Seitenfalten unten gegeneinander gewachsen
und mit ihren Rändern in der Mittellinie
der Bauchseite verschmolzen (R Naht oder
Raphe). Nun tritt das Atemwasser aus der
Darmhöhle (Z>) in die Mantelhöhle (A). Die
Buchstaben bedeuten überall dasselbe: N
Markrohr, Ch Chorda, M Seitenmuskeln, L h
Leibeshöhle, G Teil der Leibeshöhle, in
welchem sich später die Geschlechtsorgane
bilden. D Darmhöhle, ausgekleidet vom Darmdrüsenblatt
(a), A Mantelhöhle, K Kiemenspalte,
b — E Oberhaut oder Epidermis,
E x dieselbe als viscerales Epithel der Mantelhöhle,
E 2 dieselbe als parietales Epithel der
Mantelhöhle.
(Fig. 273— 275 Lh), ist beim erwachsenen Amphioxus sehr eng,
auf einen sehr schmalen Raum reduziert. Nachdem die Peribranchialhöhle
des Amphioxus gebildet ist, tritt das Atemwasser,
welches durch den Mund aufgenommen wurde, nicht mehr direkt
durch die Kiemenspalten nach außen, sondern durch das Kiemenloch
oder den Mantelporus (Taf. XIX, Fig. 15 p). Der hinter dem