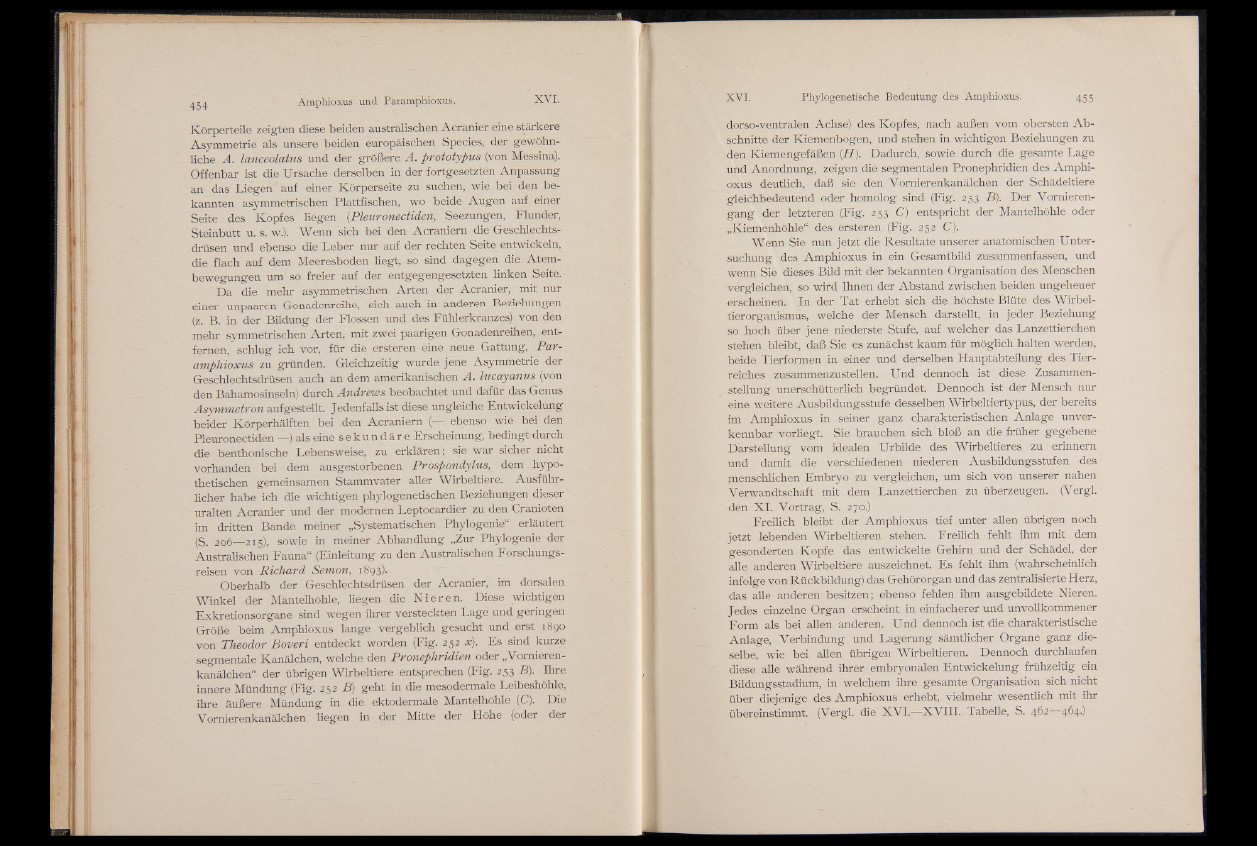
Körperteile zeigten diese beiden australischen Acranier eine stärkere
Asymmetrie als unsere beiden europäischen Species, der gewöhnliche
A. lanceolatus und der größere A. prototypus (von Messina).
Offenbar ist die Ursache derselben in der fortgesetzten Anpassung
an das Liegen’ auf einer Körperseite zu suchen, wie bei den bekannten
asymmetrischen Plattfischen, wo beide Augen auf einer
Seite des Kopfes liegen [Pleuronectiden, Seezungen, Flunder,
Steinbutt u. s. w.). Wenn sich bei den Acraniern die Geschlechtsdrüsen
und ebenso die Leber nur auf der rechten Seite entwickeln,
die flach auf dem Meeresboden liegt, so sind dagegen die Atembewegungen
um so freier auf der entgegengesetzten linken Seite.
Da die mehr asymmetrischen Arten der Acranier, mit nur
einer unpaaren Gonadenreihe, sich auch in anderen Beziehungen
(z. B. in der Bildung der Flossen und des Fühlerkranzes) von den
mehr symmetrischen Arten, mit zwei paarigen Gonadenreihen, ent-,
fernen, schlug ich vor, für die ersteren eine neue Gattung, Paramphioxus
zu gründen. Gleichzeitig wurde jene Asymmetrie der
Geschlechtsdrüsen auch an dem amerikanischen A. lucayanus (von
den Bahamosinseln) durch Andrews beobachtet und dafür das Genus
Asymmetron auf gestellt. Jedenfalls ist diese ungleiche Entwickelung
beider Körperhälften bei den Acraniern ((fjpebenso wié bei den
Pleuronectiden —) als eine s ekundär e Erscheinung, bedingt durch
die benthonische Lebensweise, zu erklären; sie war sicher nicht
vorhanden bei dem ausgestorbenen Prospondylus, dem hypothetischen
gemeinsamen Stammvater aller Wirbeltiere. Ausführlicher
habe ich die wichtigen phylogenetischen Beziehungen dieser'
uralten Acranier und der modernen Leptocardier zu den Cranioten
im dritten Bande meiner „Systematischen PhylOgenie“ erläutert
(S. 206— 215), sowie in meiner Abhandlung „Zur Phylogenie der
Australischen Fauna“ (Einleitung zu den Australischen Forschungsreisen
von Richard Semon, 1893).
Oberhalb der Geschlechtsdrüsen der Acranier, im dorsalen
Winkel der Mantelhöhle, liegen die N Leren. Diese wichtigen
Exkretionsorgane sind wegen ihrer versteckten Lage und geringen
Größe beim Amphioxus lange vergeblich gesucht und erst 1890
von Theodor Boveri entdeckt worden (Fig. 252 x). Es sind kurze
segmentale Kanälchen, welche den Pronephridien oder „Vornierenkanälchen“
der übrigen Wirbeltiere entsprechen (Fig. 253 E). Ihre
innere Mündung (Fig. 252 B) geht in die mesodermale Leibeshöhle,
ihre äußere Mündung in die ektodermale Mantelhöhle (C). Die
Vornierenkanälchen liegen in der Mitte der Höhe (öder der
dorso-ventralen Achse) des Kopfes, nach außen vom obersten Abschnitte
der Kiemenbogen, und stehen in wichtigen Beziehungen zu
den Kiemengefäßen (H). Dadurch, sowie durch die gesamte Lage
und Anordnung, zeigen die segmentalen Pronephridien des Amphioxus
deutlich, daß sie den Vornierenkanälchen der Schädeltiere
gleichbedeutend oder homolog sind (Fig. 253 B). Der Vornieren-
gang der letzteren (Fig. 253 C) entspricht der Mantelhöhle oder
„Kiemenhöhle“ des ersteren (Fig. 252 C).
Wenn Sie nun jetzt die Resultate unserer anatomischen Untersuchung
des Amphioxus in ein Gesamtbild zusammenfassen, und
wenn Sie dieses Bild mit der bekannten Organisation des Menschen
vergleichen, so wird Ihnen der Abstand zwischen beiden ungeheuer
erscheinen. In der Tat erhebt sich die höchste Blüte des Wirbeltierorganismus,
welche der Mensch darstellt, in jeder Beziehung
so hoch über jene niederste Stufe, auf welcher das Lanzettierchen
stehen bleibt, daß Sie es zunächst kaum für möglich halten werden,
beide Tierformen in einer und derselben Hauptabteilung des Tierreiches
zusammenzustellen. Und dennoch ist diese Zusammen-'
Stellung unerschütterlich begründet. Dennoch ist der Mensch nur
eine weitere Ausbildungsstufe desselben Wirbeltiertypus, der bereits
im Amphioxus in seiner ganz charakteristischen Anlage unverkennbar
vorliegt. Sie brauchen sich’ bloß an die früher gegebene
Darstellung vom idealen Urbilde des Wirbeltieres zu erinnern
und damit die verschiedenen niederen Ausbildungsstufen des
.menschlichen Embryo zu vergleichen, um. sich von unserer nahen
Verwandtschaft mit dem Lanzettierchen zu überzeugen. (Vergl.
den XI. Vortrag, S. 270.)
Freilich bleibt der Amphioxus tief unter allen übrigen noch
jetzt lebenden Wirbeltieren stehen. Freilich fehlt ihm mit dem
gesonderten Kopfe das entwickelte Gehirn und der Schädel, der
alle anderen Wirbeltiere auszeichnet. Es fehlt ihm (wahrscheinlich
infolge von Rückbildung) das Gehörorgan und das zentralisierte Herz,
das alle anderen besitzen; ebenso fehlen ihm ausgebildete Nieren.
Jedes einzelne Organ erscheint in einfacherer und unvollkommener
Form als bei allen anderen. Und dennoch ist die charakteristische
Anlage, Verbindung und Lagerung sämtlicher Organe ganz dieselbe,
wie bei allen übrigen Wirbeltieren. Dennoch durchlaufen
diese alle während ihrer embryonalen Entwickelung frühzeitig ein
Bildungsstadium, in welchem ihre gesamte Organisation sich nicht
über diejenige des Amphioxus erhebt, vielmehr wesentlich mit ihr
übereinstimint, (Vergl. die XVI.—XVIII. Tabelle, S. 462—464.)