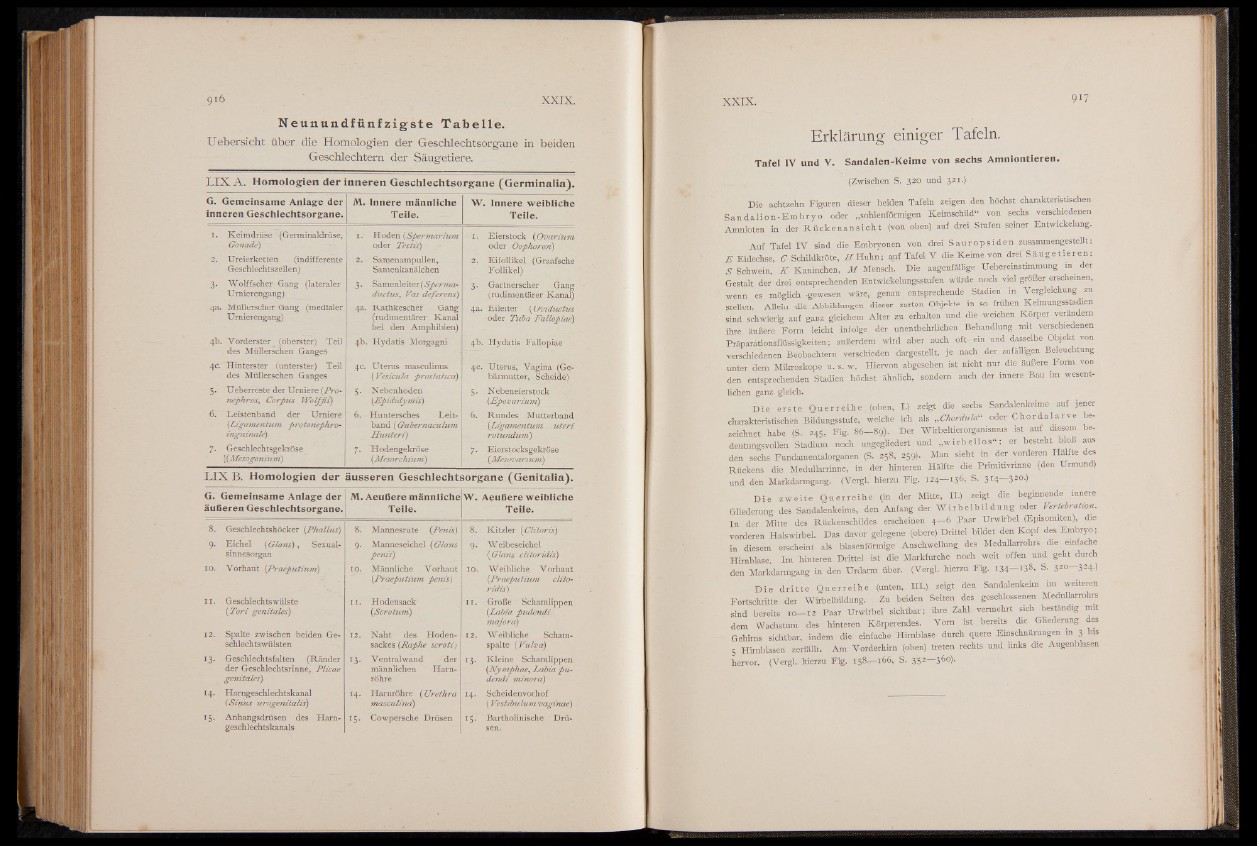
Neunundfünfzigste Tabelle.
Uebersicht über die Homologien der Geschlechtsorgane in beiden
Geschlechtern der Säugetiere.
LIX A. Homologien der inneren Geschlechtsorgane (Germinalia).
G. Gemeinsame Anlage der
M. Innere männliche
inneren Geschlechtsorgane.
Telle.
w Innere weibliche
Telle.
I. Keimdrüse (Germinaldrüse,
Gonade)
I. Hoden {Spermarium
oder Testis)
I. Eierstock {Ovarium
oder Oophoron)
2. Ureierketten (indifferente
Geschlechtszellen)
2. Samenampullen,
Samenkanälchen
2. Eifollikel (Graafsche
Follikel)
- 3* Wolffscher Gang (lateraler
Urnierengang)
3. Samenleiter (Spermaductus,
Vas deferens)
3 * Gartnerscher Gang
(rudimentärer Kanal)
4a Müllerscher Gang (medialer
Urnierengang)
4a. Rathkescher Gang
(rudimentärer Kanal
bei den Amphibien)
4a. Eileiter {Oviductus
oder Tuba Pallopiae)
4b. Vorderster (oberster) Teil
des Müllerschen Ganges
4b. Hydatis Morgagni 4b. Hydatis Fallopiae
4c Hinterster (unterster) Teil
des Müllerschen Ganges
4c. Uterus masculinus
{Vesicula prostatica)
4c. Uterus, Vagina (Gebärmutter,
Scheide)
5* Ueberreste der Urniere {Pronephros,
Corpus W o lffii)
5. Nebenhoden
(Epididym is)
5- Nebeneierstock ;
(Epovarium)
6. Leistenband der Urniere
(.Ligamentum protohephro-
inguinali)
6. Huntersches Leitband
( Gubernaculum
H unteri)
6. Rundes Mutterband
(Ligamentum _ u te r i
rotundum)
7- Geschlechtsgekröse
[{Mesogonium)
{Mesorchium) 7- Eierstocksgekröse
7. Hodengekröse
{Mesovanuni)
LIX B. H om o lo g ien d e r ä u s s e r e n G e s ch le ch t so rg a n e (G e n ita lia ) .
G. Gemeinsame Anlage der
M. Aeußere männliche
äußeren Geschlechtsorgane.
Teile.
W. Aeußere weibliche
Teile.
8. Geschlechtshöcker {Phallus) &. Mannesrute .{Penis) 8. Kitzler (C litoris}
9 - Eichel {G la n s), Sexualsinnesorgan
penis) 9- "Weibeseichel
9. Manneseichel {Glans
{Glans clitoridis)
IO. Vorhaut {Praeputium) 10. Männliche Vorhaut
{Praeputium penis)
IO. Weibliche Vorhaut
{Praeputium clitorid
is)
II . Geschlechtswülste
{T o ri genitales)
i l . Hodensack
{Scrotum)
II. Große Schamlippen
{Labia pudendi
majora)
12. Spalte zwischen beiden Geschlechtswülsten
12. Naht des Hodensackes
{Raphe scroti)
12. Weibliche Schamspalte
( Vulva)
13- Geschlechtsfalten (Ränder
der Geschlechtsrinne, Plicae
genitales)
13. Ventral wand der
männlichen Harnröhre
13- Kleine Schamlippen
{Nymphae, Labia p u dendi
minora)
14. Harngeschlechtskanal
(S in u s uro genitalis)
14. Harnröhre {Urethra
masculine1)
14. S cheiden vorhof
( Vestibulum vaginae)
15- Anhangsdrüsen des Harngeschlechtskanals
15* Cowpersche Drüsen I 5- Bartholinische Drüsen.
Erklärung einiger Tafeln.
Tafel IV und V. Sandalen-Keime von sechs Amniontieren.
(Zwischen S. 320 und 321.)
Die achtzehn Figuren dieser beiden Tafeln zeigen den höchst charakteristischen
S a n d a l io n -E m b r y o oder „sohlenfönnigen Keimschild“ von sechs verschiedenen
Amnioten in der R ü c k e n a n s ic h t (von oben) auf drei Stufen seiner Entwickelung.
Auf Tafel TV sind die Embryonen von drei S a u r o p s id e n zusammengestellt:
JE Eidechse, C Schildkröte, R Huhn; auf Tafel V die Keime von drei S ä u g e t ie r e n :
S Schwein, K Kaninchen, M Mensch. Die augenfällige Uebereinstimmung m der
Gestalt der drei entsprechenden Entwickelungsstufen würde noch viel größer erscheinen,
wenn es möglich -gewesen wäre, genau entsprechende Stadien in Vergleichung zu
stellen. Allein die. Abbildungen dieser zarten Objekte in so frühen Keimungsstadien
sind schwierig auf ganz gleichem Alter zu erhalten und die weichen Körper verändern
ihre äußere Form leicht infolge der unentbehrlichen Behandlung mit verschiedenen
Präparationsflüssigkeiten; außerdem wird aber auch Oft-ein und dasselbe Objekt von
verschiedenen Beobachtern verschieden dargestellt, je nach der zufälligen Beleuchtung
unter'dem Mikroskope u. s. w. Hiervon abgesehen ist nicht nur die äußere,Form von
den entsprechenden Stadien höchst ähnlich, sondern auch der innere Bau un wesent-
liehen ganz gleich.
D ie . e r s te Q u e r r e ih e job en, I.) zeigt die sechs Sandalenkeime auf jener
charakteristischen Bildungsstufe, welche ich als „ Chordula“ oder C h o r d a la r v e bezeichnet
habe (S. 245, Fig. 86— 89). Der Wirbeltierorganismus ist auf diesem bedeutungsvollen
Stadium noch ungegliedert und „w i r b e l lo s “ ; er besteht bloß aus
den sechs Fundamentaloiganen (S. 258, 259). Man sieht in der vorderen Hälfte des
Rückens die Medullarrinne/ in der hinteren Hälfte die Primitivnnne (den Urmund)
und dén Markdarmgang. (Vergl. hierzu Fig. 124— 136, S. 314— 320.)
D i e zw e i t e Q u e r r e ih e (in der Mitte, H.) zeigt die beginnende innere
Gliederung des Sandalenkeims, den Anfang der W i r b e lb i ld u n g oder Vertebration.
In der Mitte des Rückenschildes erscheinen 4— 6 Paar Urwirbel (Episomiten), die
vorderen Halswirbel. Das davor gelegene (obere) Drittel bildet den Kopf des Embryo;
in diesem erscheint als blasenförmige Anschwellung des Medullarrohrs die einfache
Himblase. Im hinteren Drittel ist die Markfurche noch weit offen und geht durch
den Markdarmgang in den Urdarm über. (Vergl. hierzu Fig. 134^-138, S. 320— 324.)
D i e d r i t t e Q u e r r e ih e (unten, IH.) zeigt den Sandalenkeim im weiteren
Fortschritte der Wirbelbildung. Zu beiden Seiten des geschlossenen Medullarrohrs
sind bereits 10— 12 Paar Urwirbel sichtbar; ihre Zahl:• vermehrt sich beständig mit
dem Wachstum des hinteren Körperendes. Vom ist .bereits die Gliederung des
Gehirns sichtbar, indem die einfache Hirnblase durch quere Einschnürungen m 3 bis
5 Himblasen zerfällt. Am Vorderhim (oben) treten rechts und links die Augenblasen
hervor. (Vergl. hierzu Fig. 1587—166, S. 352— 3^ö).