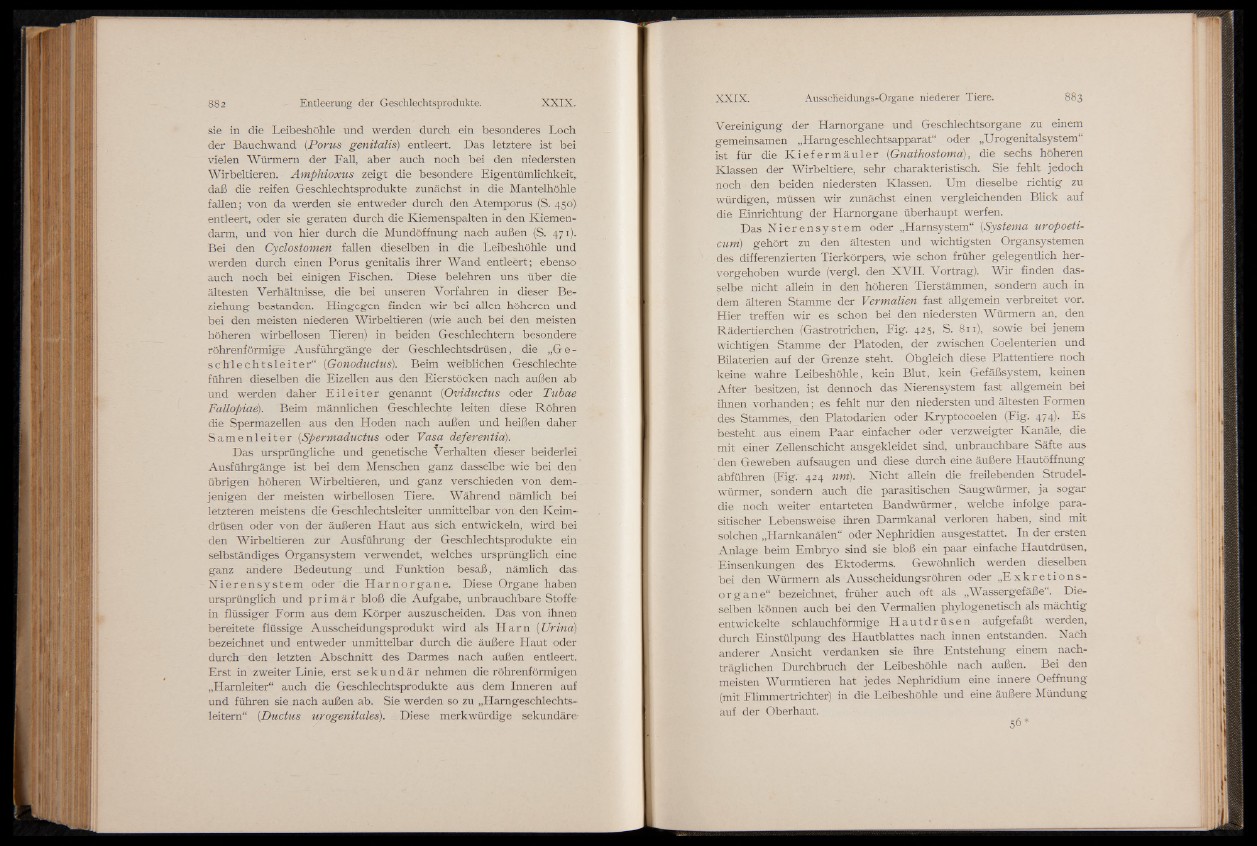
sie in die Leibeshöhle und werden durch ein besonderes Loch
der Bauchwand (Porus genitalis) entleert. Das letztere ist bei
vielen Würmern der Fall, aber auch noch bei den niedersten
Wirbeltieren. Amphioxus zeigt die besondere Eigentümlichkeit,
daß die reifen Geschlechtsprodukte zunächst in die Mantelhöhle
fallen; von da werden sie entweder durch den Atemporus (S. 450)
entleert, oder sie geraten durch die Kiemenspalten in den Kiemendarm,
und von hier durch die Mundöffnung nach außen (S. 471).
Bei den Cyclostomen fallen dieselben in die Leibeshöhle und
werden durch einen Porus genitalis ihrer Wand entleert; ebenso
auch noch bei einigen Fischen. Diese belehren uns über die
ältesten Verhältnisse, die bei unseren Vorfahren in dieser Beziehung
bestanden. Hingegen finden wir bei allen höheren und
bei den meisten niederen Wirbeltieren (wie auch bei den meisten
höheren wirbellosen Tieren) in beiden Geschlechtern besondere
röhrenförmige Ausführgänge der Geschlechtsdrüsen, die „Ge-
s chl e cht s l e i t e r “ (Gonoductus). Beim weiblichen Geschlechte
führen dieselben die Eizellen aus den Eierstöcken nach außen ab
und werden daher Ei l e i t e r genannt (Oviductus oder Tubae
Fallopiae). Beim männlichen Geschlechte leiten diese Röhren
die Spermazellen aus den Hoden nach außen und heißen daher
Samenle i te r (Spermaductus oder Vasa deferentia).
Das ursprüngliche und genetische Verhalten dieser beiderlei
Ausführgänge ist bei dem Menschen ganz dasselbe' wie bei den
übrigen höheren Wirbeltieren, und ganz verschieden von demjenigen
der meisten wirbellosen Tiere. Während nämlich bei
letzteren meistens die Geschlechtsleiter unmittelbar von den Keimdrüsen
oder von der äußeren Haut aus sich entwickeln, wird, bei
den Wirbeltieren zur Ausführung der Geschlechtsprodukte ein
selbständiges Organsystem verwendet, welches ursprünglich eine
ganz andere Bedeutung und Funktion besaß, nämlich das-
Nie r ens ys t em oder die Harnorgane. Diese Organe haben
ursprünglich und pr imär bloß die Aufgabe, unbrauchbare Stoffein
flüssiger Form aus dem Körper auszuscheiden. Das von ihnen
bereitete flüssige Ausscheidungsprodukt wird als Harn (Urina)
bezeichnet und entweder unmittelbar durch die äußere Haut oder
durch den letzten Abschnitt des Darmes nach außen entleert.
Erst in zweiter Linie, erst sekundär nehmen die röhrenförmigen
„Harnleiter“ auch die Geschlechtsprodukte aus dem Inneren auf
und führen sie nach außen ab. Sie werden so zu „Harngeschlechtsleitern“
(Ductus urogenitales). Diese merkwürdige sekundäre-
Vereinigung der Harnorgane und Geschlechtsorgane zu einem
gemeinsamen „Harngeschlechtsapparat“ oder „Urogenitalsystem“
ist für die Ki e f e rmäu l e r (Gnathostoma), die sechs höheren
Klassen der Wirbeltiere, sehr charakteristisch. Sie fehlt jedoch
noch den beiden niedersten Klassen. Um dieselbe richtig zu
würdigen, müssen wir zunächst einen vergleichenden Blick auf
die Einrichtung der Harnorgane überhaupt werfen.
Das Nierensys tem oder „Harnsystem“ (Systema uropoeti-
cum) gehört zu den ältesten und wichtigsten Organsystemen
des differenzierten Tierkörpers, wie schon früher gelegentlich hervorgehoben
wurde (vergl. den XVII. Vortrag). Wir finden dasselbe
nicht allein in den höheren Tierstämmen, sondern auch in
dem älteren Stamme der Vermalten fast allgemein verbreitet vor.
Hier treffen wir es schon bei den niedersten Würmern an, den
Rädertierchen (Gastrotrichen, Fig. 425, S. 811), sowie bei jenem
wichtigen Stamme der Platoden, der zwischen Coelenterien und
Bilaterien auf der Grenze steht Obgleich diese Plattentiere noch
keine währe Leibeshöhle, kein Blut, kein Gefäßsystem, keinen
After besitzen, ist dennoch das Nierensystem fast allgemein bei
ihnen vorhanden; es fehlt nur den niedersten und ältesten Formen
des Stammes, den Platodarien oder Kryptocoelen (Fig. 474). Es
besteht aus einem Paar einfacher oder verzweigter Kanäle, die
mit einer Zellenschicht ausgekleidet sind, unbrauchbare Säfte aus
den Geweben aufsaugen und diese durch eine äußere Hautöffnung
abführen (Fig. 424 nm). Nicht allein die freilebenden Strudelwürmer,
sondern auch die parasitischen Saugwürmer, ja sogar
die noch weiter entarteten Bandwürmer, welche infolge parasitischer
Lebensweise ihren Darmkanal verloren haben, sind mit
solchen „Harnkanälen“ oder Nephndien ausgestattet. In der ersten
Anlage beim Embryo sind sie bloß ein paar einfache Hautdrüsen,
Einsenkungen des Ektoderms. Gewöhnlich werden dieselben
bei den Würmern als Ausscheidungsröhren oder „Exkr e t iöns -
organe “ bezeichnet, früher auch oft als „Wassergefäße“. Dieselben
können auch bei den Vermaßen phylogenetisch als mächtig
entwickelte schlauchförmige Hautdrüsen auf gef aßt werden,
durch Einstülpung des Hautblattes nach innen entstanden. Nach
anderer Ansicht verdanken sie ihre Entstehung einem nachträglichen
Durchbruch der Leibeshöhle nach außen. Bei den
meisten Wurmtieren hat jedes Nephridium eine innere Oeffnung
(mit Flimmertrichter) in die Leibeshöhle und eine äußere Mündung
auf der Oberhaut.