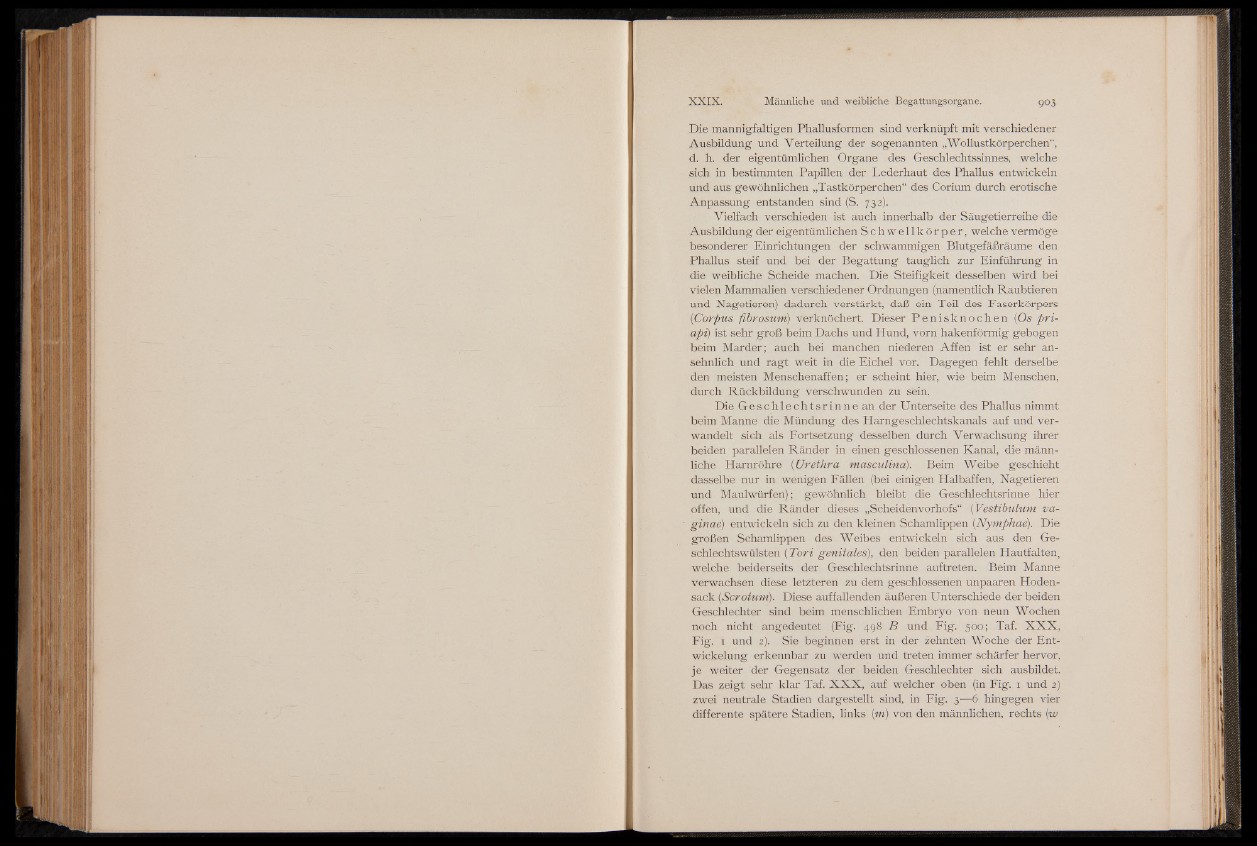
X X I X . M än n lich e u nd -weibliche Begattungsorgane. 903
Die mannigfaltigen Phallusformen sind verknüpft mit verschiedener
Ausbildung und Verteilung der sogenannten „Wollustkörperchen“,
d. h. der eigentümlichen Organe des Geschlechtssinnes, welche
sich in bestimmten Papillen der Lederhaut des Phallus entwickeln
und aus gewöhnlichen „Tastkörperchen“ des Corium durch erotische
Anpassung entstanden sind (S. 732).
Vielfach verschieden ist auch innerhalb der Säugetierreihe die
Ausbildung der eigentümlichen S chwe l lk ö rpe r , welche vermöge
besonderer Einrichtungen der schwammigen Blutgefäßräume den
Phallus steif und bei der Begattung tauglich zur Einführung in
die weibliche Scheide machen. Die Steifigkeit desselben wird bei
vielen Mammalien verschiedener Ordnungen (namentlich Raubtieren
und Nagetieren) dadurch verstärkt, daß ein Teil des Faserkörpers
(Corpus fibrosum) verknöchert. Dieser Peni sknochen (Os pri-
api) ist sehr groß beim Dachs und Hund, vorn hakenförmig gebogen
beim Marder; auch bei manchen niederen Affen ist er sehr ansehnlich
und ragt weit in die Eichel vor. Dagegen fehlt derselbe
den meisten Menschenaffen; er scheint hier, wie beim Menschen,
durch Rückbildung verschwunden zu sein.
Die Ge s chle cht s r inne an der Unterseite des Phallus nimmt
beim Manne die Mündung des Harngeschlechtskanals auf und verwandelt
sich als Fortsetzung desselben durch Verwachsung ihrer
beiden parallelen Ränder in einen geschlossenen Kanal, die männliche
Harnröhre (Urethra masculina). Beim Weibe geschieht
dasselbe nur in wenigen Fällen (bei einigen Halbaffen, Nagetieren
und Maulwürfen); gewöhnlich bleibt die Geschlechtsrinne hier
offen, und die Ränder dieses „Scheidenvorhofs“ (Vestibulum vaginal)
entwickeln sich zu den kleinen Schamlippen (Nymphae). Die
großen Schamlippen des Weibes entwickeln sich aus den Geschlechtswülsten
(Tori genitales), den beiden parallelen Hautfalten,
welche beiderseits der Geschlechtsrinne auftreten. Beim Manne
verwachsen diese letzteren zu dem geschlossenen unpaaren Hodensack
(Scrotum). Diese auffallenden äußeren Unterschiede der beiden
Geschlechter sind beim menschlichen Embryo von neun Wochen
noch nicht angedeutet (Fig. 498 B und Fig. 500; Taf. XXX,
Fig. 1 und 2). Sie beginnen erst in der zehnten Woche der Entwickelung
erkennbar zu werden und treten immer schärfer hervor,
je weiter der Gegensatz der beiden Geschlechter sich ausbildet.
Das zeigt sehr klar Taf. XXX, auf welcher oben (in Fig. 1 und 2)
zwei neutrale Stadien dargestellt sind, in Fig. 3—6 hingegen vier
differente spätere Stadien, links (m) von den männlichen, rechts (w