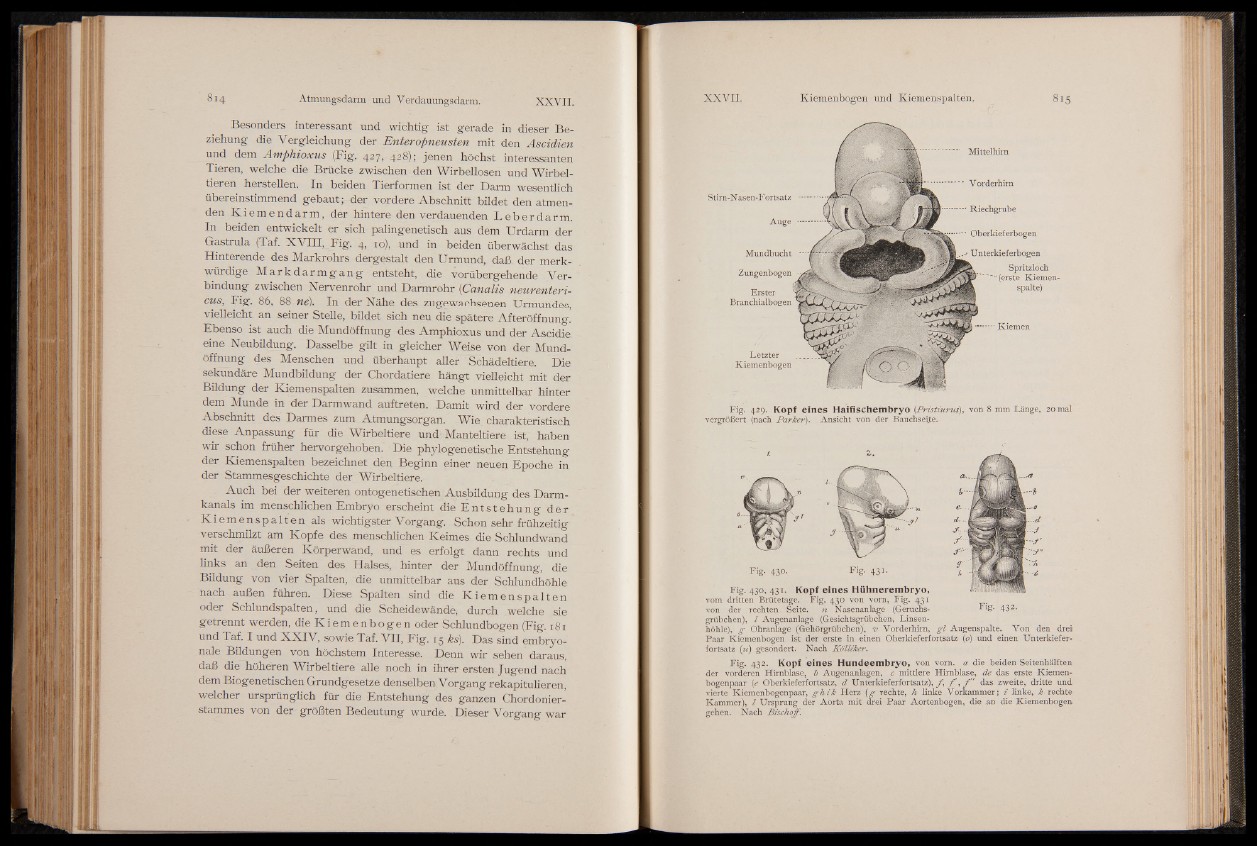
Besonders interessant und wichtig ist gerade in dieser Beziehung
die Vergleichung der Enteropneusten mit den Ascidien
und dem Amphioxus (Fig. 427, 428); jenen höchst interessanten
Tieren, welche die Brücke zwischen den Wirbellosen und Wirbeltieren
herstellen. In beiden Tierformen ist der Darm wesentlich
übereinstimmend gebaut; der vordere Abschnitt bildet den atmenden
Kiemenda rm, der hintere den verdauenden Leberdarm.
In beiden entwickelt er sich palingenetisch aus dem Urdarm der
Gastrula (Taf. XVIII, Fig. 4, 10), und in beiden überwächst das
Hinterende des Markrohrs dergestalt den Urmund, daß. der merkwürdige
Ma r kd a rmg an g entsteht, die vorübergehende Verbindung
zwischen Nervenrohr und Darmrohr (Canalis neurenteri-
cus, Fig. 86, 88 ne). In der Nähe des zugewachsenen Urmundes,
vielleicht an seiner Stelle, bildet sich neu die spätere Afteröffnung.'
Ebenso ist auch die Mundöffnung des Amphioxus und der Ascidie
eine Neubildung. Dasselbe gilt in gleicher Weise von der Mundöffnung
des Menschen und überhaupt aller Schädeltiere. Die
sekundäre Mundbildung der Chordatiere hängt vielleicht mit der
Bildung der Kiemenspalten zusammen, welche unmittelbar hinter
dem Munde in der Darmwand auftreten. Damit wird der vordere
Abschnitt des Darmes zum Atmungsorgan. Wie charakteristisch
diese Anpassung für die Wirbeltiere und Manteltiere ist, haben
wir schon früher hervorgehoben. Die phylogenetische Entstehung
der Kiemenspalten bezeichnet den Beginn einer neuen Epoche in
der Stammesgeschichte der Wirbeltiere.
Auch bei der weiteren ontogenetischen Ausbildung des Darmkanals
im menschlichen Embryo erscheint die Ent s t ehung der
Kiemenspa l t en als wichtigster Vorgang. Schon sehr frühzeitig
verschmilzt am Kopfe des menschlichen Keimes die Schlundwand
mit der äußeren Körperwand, und es erfolgt dann rechts Und
links an den Seiten des Halses, hinter der Mundöffnung, die
Bildung von vier Spalten, die unmittelbar aus der Schlundhöhle
nach außen führen. Diese Spalten sind die Kiemenspa l ten
oder Schlundspalten, und die Scheidewände, durch welche sie
getrennt werden, die Ki eme nb o g e n oder Schlundbogen (Fig. 181
nnd Taf. I und XXIV, sowie Taf. VII, Fig. 15 ks). Das sind embryonale
Bildungen von höchstem Interesse. Denn wir sehen daraus,
daß die höheren Wirbeltiere alle noch in ihrer ersten Jugend nach
dem Biogenetischen Grundgesetze denselben Vorgang rekapitulieren,
welcher ursprünglich für die Entstehung des ganzen Chordonier-
stammes von der größten Bedeutung wurde. Dieser Vorgang war
Mittelhirn
Stim-N asen-Fortsatz
Auge
Mundbucht
Zungenbogen
Erster
Branchialbogen
Letzter
Kiemenbogen
Vorderhirn
Riechgrube
Oberkieferbogen
Unterkieferbogen
Spritzloch
" ’ (erste Kiemenspalte)
Kiemen
Fig. 429. Kopf eines Haifischembryo {Przstiurzis), von 8 mm Länge, 20 mal
vergrößert (nach Parker). Ansicht von der Bauchseite.
vom dritten Brütetage. Fig. 430 von vorn, Fig. 431
von der rechten Seite. n Nasenanlage (Geruchs- 4 3 2-
griibchen), l Augenanlage (Gesichtsgnibchen, Linsenhöhle),
g Ohranlage (Gehörgrübchen), v Vorderhirn, g l Augenspalte. Von den drei
Paar Kiemenbogen ist der erste in einen Oberkieferfortsatz (o) und einen Unterkieferfortsatz
(u) gesondert. Nach K ölliker.
Fig. 432. Kopf eines Hundeembryo, von vorn, a die beiden Seitenhälften
der vorderen Hirnblase, b Augenanlagen, c mittlere Himblase, de das erste Kiemenbogenpaar
(e Oberkieferfortsatz, d Unterkieferfortsatz), ƒ , ƒ ', f " das zweite, dritte und
vierte Kiemenbogenpaar, g h i k Herz (g rechte, h linke Vorkammer; i linke, £ rechte
Kammer), l Ursprung der Aorta mit drei Paar Aortenbogen, die an die Kiemenbogen
gehen. Nach Bischoff,