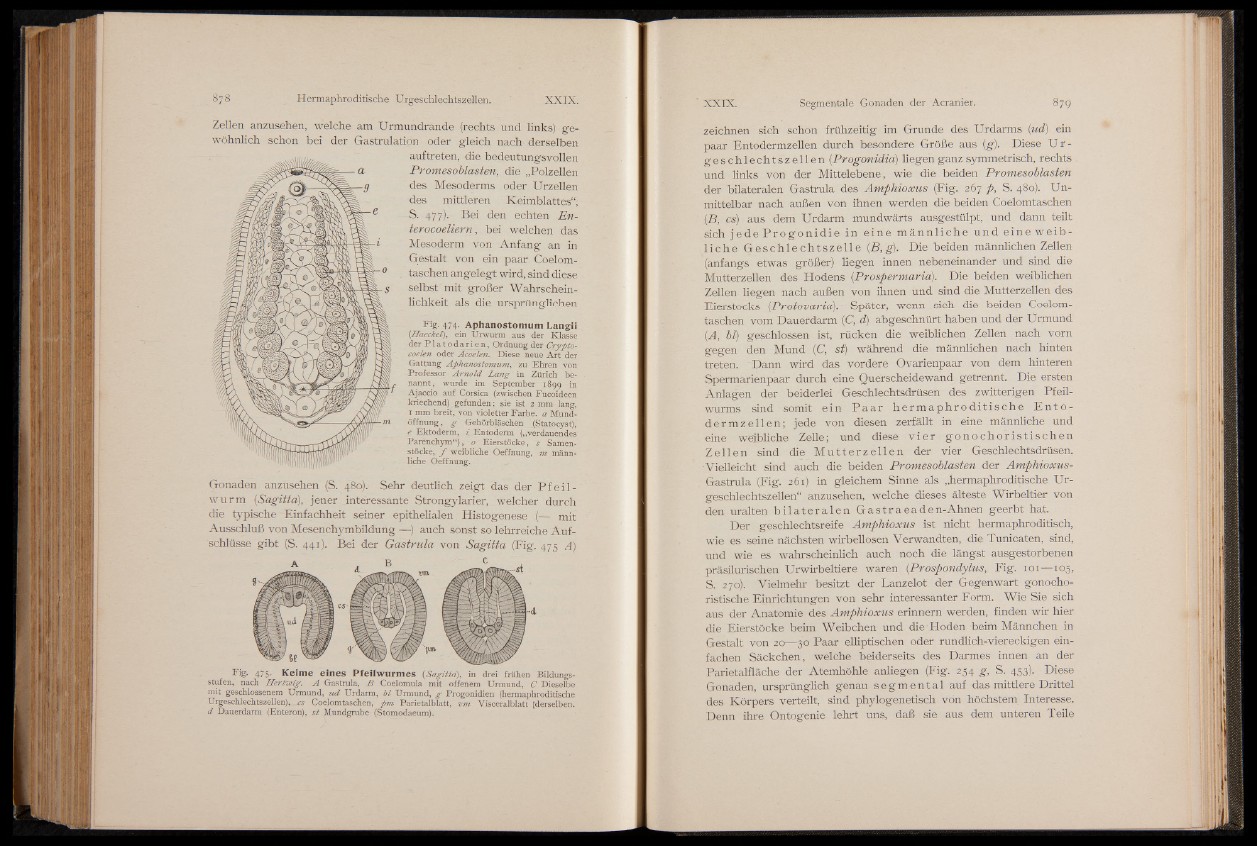
Zellen anzusehen, welche am Urmundrande (rechts und links) gewöhnlich
schon bei der Gastrulation oder gleich nach- derselben
auftreten, die bedeutungsvollen
a Promesoblasten, die „Polzellen
g des Mesoderms oder Urzellen
des mittleren Keimblattes“,
e S. 477). Bei den echten Enter
ocoeliern , bei welchen das
i Mesoderm von Anfang an in
Gestalt von ein paar Coelom-
0 . taschen angelegt wird, sind diese
S selbst mit großer Wahrscheinlichkeit
als die ursprünglichen
Fig. 474. A p h an o s tom um Lang!!
(Haeckel), ein Urwurm aus der Klasse
der P la to d a r ie n , Ordnung der Crypto-
coelen oder Äcoelen. Diese neue Art der
Gattung Aphanostomum, zu Ehren von
Professor A rno ld Lang in Zürich benannt,
wurde im September 1899 in
Ajaccio auf Corsica (zwischen Fucoideen
kriechend) gefunden; sie ist 2 mm lang,
1 mm breit, von violetter Farbe, a Mund-
m Öffnung, g Gehörbl^schen (Statpcyst),
e Ektoderm, . I Entoderm („verdauendes
Parenchym“) , Eierstöcke, j Samenstöcke,
f weibliche Oeffmmg, m männliche
Oeffnung.
Gonaden anzusehen (S. 480). Sehr deutlich zeigt das der P f e i l wurm
(Sagitta), jener interessante Strongylarier, welcher durch
die typische Einfachheit seiner epithelialen Histogenese (— mit
Ausschluß von Mesenchymbildung —) auch sonst so lehrreiche Aufschlüsse
gibt (S. 441). Bei der Gastrula von Sagitta (Fig. 475 A)
Ffbj 475- Keime eines Pfeilwurmes [Sagitta), in drei frühen Bildungsstufen,
nach H ertw ig. A Gastrula, B Coelomula mit offenem Urmund, C Dieselbe
mit geschlossenem XJrmund, u d Urdarm, b l Urmund, g Progonidien (liermaphroditische
Urgeschlechtszellen),—er Coelomtaschen, pm Parietalblatt, vrn Visceralblatt [derselben.
d Dauerdarm (Enteron), s t Mundgrube (Stomodaeum).
zeichnen sich schon frühzeitig im Grunde des Urdarms {ud) ein
paar Entodermzellen durch besondere Größe aus (g). Diese U r ge
s chlecht s zel len (Progonidia) Hegen ganz symmetrisch, rechts
und links von der Mittelebene, wie die beiden Promesoblasten
der bilateralen Gastrula des Amphioxus (Fig. 267 p, S. 480). Unmittelbar
nach außen von ihnen werden die beiden Coelomtaschen
(B, cs) aus dem Urdarm mundwärts ausgestülpt, und dann teilt
sich j e d eP r o g o n id i e in eine männl i che und eine we ib l
iche Ge s chl e cht s z e l le (B, g). Die beiden männlichen Zellen
(anfangs etwas größer) liegen innen nebeneinander und sind die
Mutterzellen des Hodens {Prospermaria). Die beiden weibHchen
Zellen Hegen nach außen von ihnen und sind die MutterzeHen des
Eierstocks (Protovaria). Später, wenn sich die beiden Coelomtaschen
vom Dauefdarm (C, d) abgeschnürt haben und der Urmund
(A, bl) geschlossen ist, rücken die weibHchen ZeHen nach vorn
gegen den Mund (C, st) während die männHchen nach hinten
treten. Dann wird das vordere Ovarienpaar von dem hinteren
Spermarienpaar durch eine Quefscheidewand getrennt. Die ersten
Anlagen der beiderlei Geschlechtsdrüsen des zwitterigen Pfeilwurms
sind somit ein Paar he rmaphrodi t i s che E n t o dermze
l len; jede von diesen zerfäUt in eine männHche und
eine weibHche Zehe; und diese vie r gono cho r i s t i s chen
Zel l en sind die Mut te r z e l len der vier Geschlechtsdrüsen.
VieUeicht sind auch die beiden Promesoblasten der Amphioxus-
Gastrula (Fig. 261) in gleichem Sinne als „hermaphroditische Ur-
geschlechtszeUen“ anzusehen, welche dieses älteste Wirbeltier von
den uralten bi la tera len Gastraeaden-Ahnen geerbt hat.
Der geschlechtsreife Amphioxus ist nicht hermaphroditisch,
wie es seine nächsten wirbeUosen Verwandten, die Tunicaten, sind,
und wie es wahrscheinHch auch noch die längst ausgestorbenen
präsüurischen Urwirbeltiere waren (Prospondylus, Fig. 101— 105,
S. 270). Vielmehr besitzt der Lanzelot der Gegenwart gonocho-
ristische Einrichtungen von sehr interessanter Form. Wie Sie sich
aus der Anatomie des Amphioxus erinnern werden, finden wir hier
die Eierstöcke beim Weibchen und die Hoden beim Männchen in
Gestalt von 20—30 Paar eIHptischen oder rundHch-viereckigen einfachen
Säckchen, welche beiderseits des Darmes innen an der
Parietalfläche der Atemhöhle anHegen (Fig. 254 g, S. 453). Diese
Gonaden, ursprüngHch genau segmental auf das mittlere Drittel
des Körpers verteilt, sind phylogenetisch von höchstem Interesse.
Denn ihre Ontogenie lehrt uns, daß sie aus dem unteren Teile