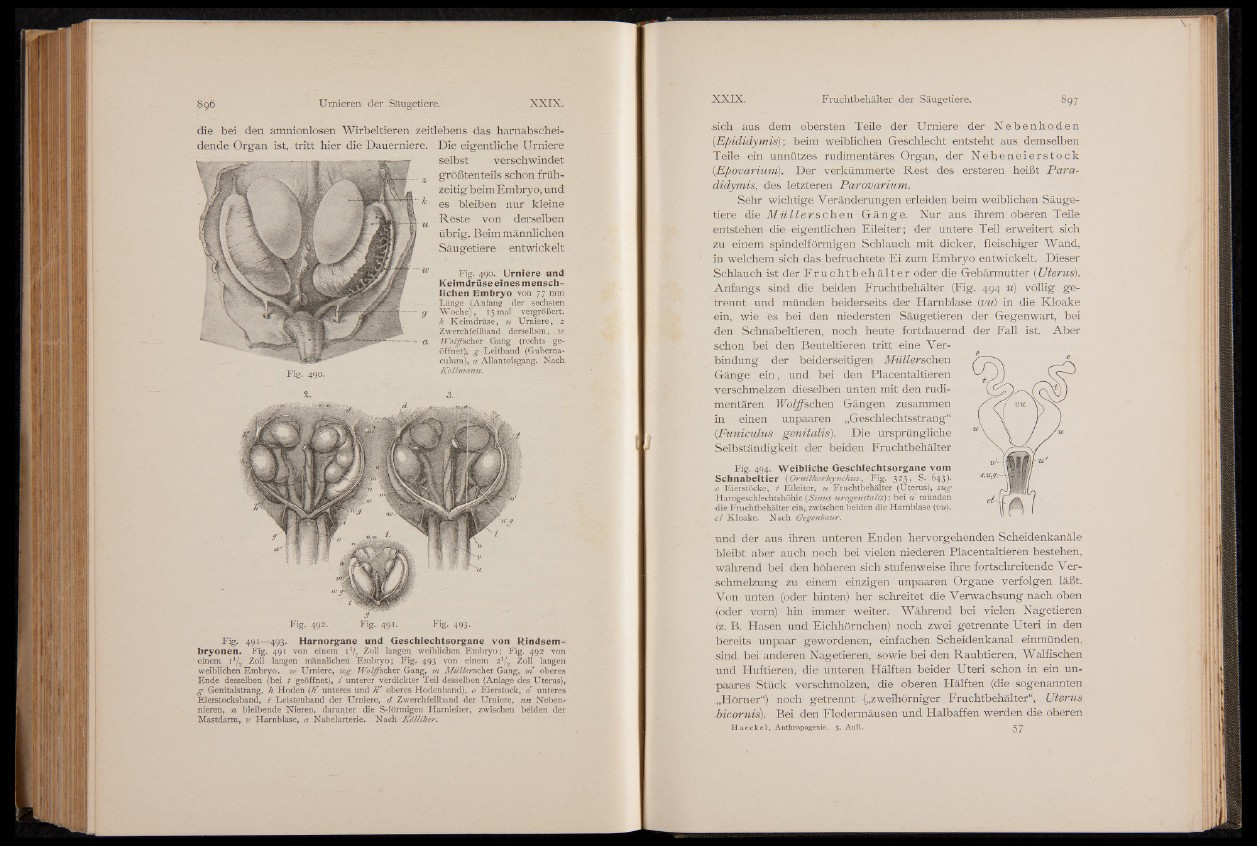
die bei den amnionlosen Wirbeltieren zeitlebens das harnabscheidende
Organ ist, tritt hier die Dauerniere. Die eigentliche Urniere
selbst verschwindet
größtenteils schon frühzeitig
beim Embryo, und
es bleiben nur kleine
Reste von derselben
übrig. Beim männlichen
Säugetiere entwickelt
Fig. 490. Urniere und
Keimdrüse eines menschlichen
Fig- 493-
Embryo von 77 mm
Länge (Anfang der sechsten
W oche), 15 mal vergrößert.
k Keimdrüse, u Urniere, z
Zwerchfellband derselben, % w
Wolffscher Gang (rechts geöffnet^
g Leitband (Guberna-
culum), a Allantoisgang. Nach
Kollm ann.
Fig. 492. Fig. 491.
Fig. 491— 493. Harnorgane und Geschlechtsorgane von Rindsembryonen.
Fig. 491 von einem 1 ffe Zoll langen weiblichen Embryo; Fig. 492 von
einem i lJ2 Zoll langen männlichen Embryo; Fig. 493 von einem 21/2 Zoll langen
weiblichen Embryo, w Urniere, wg Wölfischer Gang, m M üllerscher Gang, m oberes
Ende desselben (bei t geöffnet), i unterer verdickter Teil desselben (Anlage des Uterus),
g Genitalstrang, h Hoden {K unteres und K ' oberes Hodenband), 0 Eierstock, 0' unteres
Eierstocksband, i Leistenband der Urniere, d Zwerchfellband der Urniere, nn Nebennieren,
n bleibende Nieren, darunter die S-förmigen Harnleiter, zwischen béiden der
Mastdarm, v ''Harnblase, a Nabelarterie. Nach K ölliker.
.sich aus dem obersten Teile der Urniere der Nebenhoden
(Epididymis); beim weiblichen Geschlecht entsteht aus demselben
Teile ein unnützes rudimentäres Organ, der Nebene ie r s tock
(Epovarium). Der verkümmerte Rest des ersteren heißt Para-
didymis, des letzteren Parovarium.
Sehr wichtige Veränderungen erleiden beim weiblichen Säugetiere
die M üZ/ersehen Gänge. Nur aus ihrem oberen Teile
entstehen die eigentlichen Eileiter; der untere Teil erweitert sich
zu einem spindelförmigen Schlauch mit dicker, fleischiger Wand,
in welchem sich das befruchtete Ei zum Embryo entwickelt. Dieser
Schlauch ist der F ruchtbehä l t e r oder die Gebärmutter {Uterus).
Anfangs sind die beiden Fruchtbehälter (Fig. 494 u) völlig getrennt;
und münden beiderseits der Harnblase (vu) in die Kloake
ein, wie es bei den niedersten Säugetieren der Gegenwart, bei
den Schnabeltieren, noch heute fortdauernd der Fall ist. Aber
schon bei den Beuteltieren tritt eine Verbindung
der beiderseitigen Müllerschen
Gänge-ein, und bei den Placentaltieren
verschmelzen dieselben unten mit den rudimentären
Wolffschen Gängen zusammen
in einen unpaaren „Geschlechtsstrang“
{Funiculus genitalis). Die ursprüngliche
Selbständigkeit der beiden Fruchtbehälter
Fig. 494. Weibliche Geschlechtsorgane vom
Schnabeltier (()rnähorhynchu>, Fig. 323, S. 643).
.0 Eierstöcke, t Eileiter, u Fruchtbehälter (Uterus), sug
Harngeschlechtshöhle (S in u s urogenitalis); bei u münden
die Fruchtbehälter ein, zwischen beiden die Harnblase (vu).
x l Kloake. Nach Gegeribaur.
und der aus ihren unteren Enden hervorgehenden Scheidenkanäle
bleibt aber auch noch bei vielen niederen Placentaltieren bestehen,
während bei den höheren sich stufenweise ihre fortschreitende Verschmelzung
zu einem einzigen unpaaren Organe verfolgen läßt.
Von unten (oder hinten) her schreitet die Verwachsung nach oben
•(oder vorn) hin immer weiter. Während bei vielen Nagetieren
(z. B. Hasen und Eichhörnchen) noch zwei getrennte Uteri in den
bereits unpaar gewordenen, einfachen Scheidenkanal einmünden,
sind bei anderen Nagetieren, sowie bei den Raubtieren, Walfischen
und Huftieren, die unteren Hälften beider Uteri schon in ein un-
paares Stück verschmolzen, die oberen Hälften (die sogenannten
„Hörner“) noch getrennt („zweihörniger Fruchtbehälter“, Uterus
bicornis). Bei den Fledermäusen und Halbaffen werden die oberen
H ae ck e l, Anthropogenie. 5. Aufl.