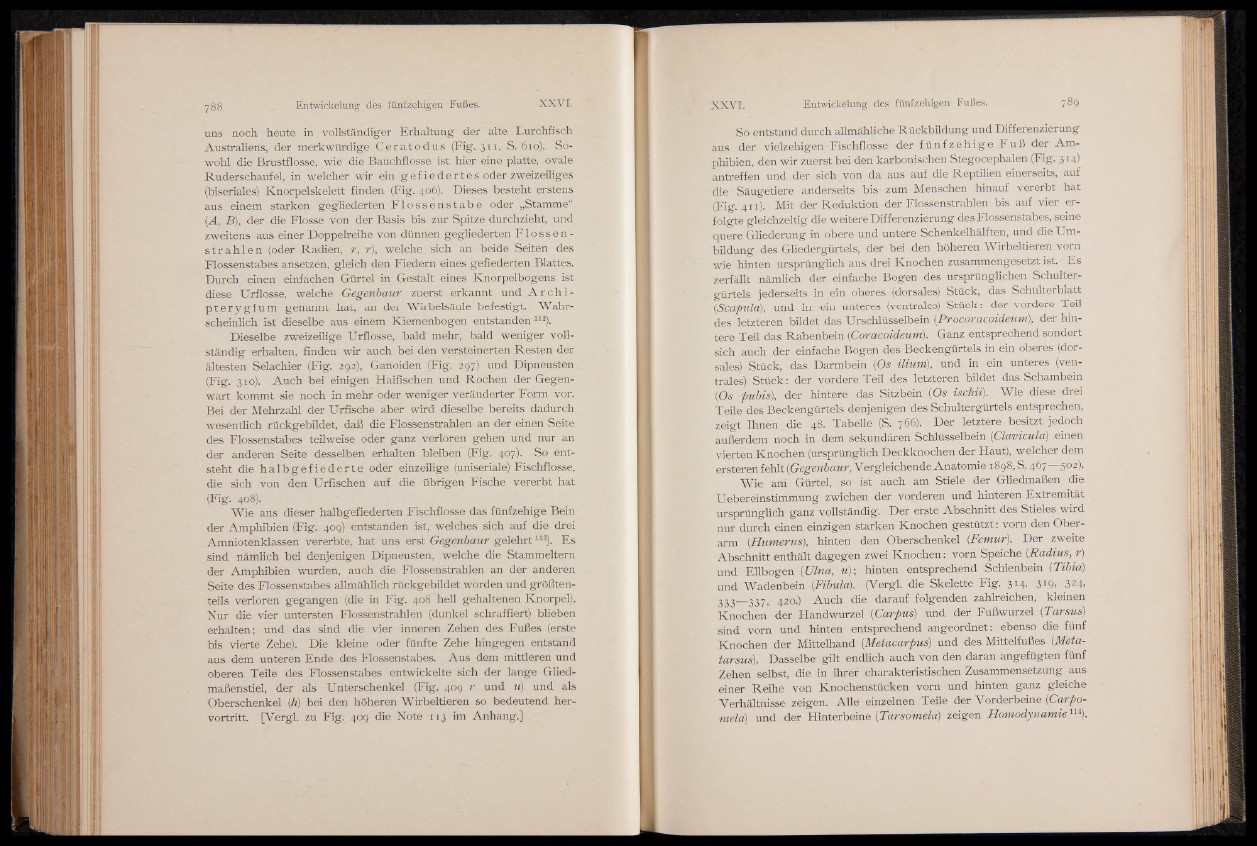
uns noch heute in vollständiger Erhaltung der alte Lurchfisch
Australiens, der merkwürdige Ceratodus (Fig. 311, S. 610). Sowohl
die Brustflosse, wie die Bauchflosse ist hier eine platte, ovale
Ruderschaufel, in welcher wir ein g e f ieder te s oder zweizeiliges
(biseriales) Knorpelskelett finden (Fig. 406). Dieses besteht erstens
aus einem starken gegliederten Flo s s ens tabe oder „Stamme“.
(A, B), der die Flosse von der Basis bis zur Spitze durchzieht, und
zweitens aus einer Doppelreihe von dünnen gegliederten F lo s s e n s
t rahlen (oder Radien, r, r), welche sich an beide Seiten des
Flossenstabes ansetzen, gleich den Fiedern eines gefiederten Blattes.
Durch einen einfachen Gürtel in Gestalt eines Knorpelbogens ist
diese Urflosse, welche Gegenbaur zuerst erkannt und Ar c h i -
pt e r yg ium genannt hat, an der Wirbelsäule befestigt. Wahrscheinlich
ist dieselbe aus einem Kiemenbogen entstanden112).
Dieselbe zweizeilige Urflosse, bald mehr, bald weniger vollständig
erhalten, finden wir auch bei den versteinerten Resten der
ältesten Selachier (Fig. 292), Ganoiden (Fig. 297) und Dipneusten
(Fig. 310). Auch bei einigen Haifischen und Rochen der Gegenwart
kommt sie noch in mehr oder weniger veränderter Form vor.
Bei der Mehrzahl der Urfische aber wird dieselbe bereits dadurch
wesentlich rückgebildet, daß die Flossenstrahlen an der einen Seite
des Flossensfabes teilweise oder ganz verloren gehen und nur an
der anderen Seite desselben erhalten bleiben (Fig. 407). So entsteht
die hä lb g e f i ed e r t e oder einzeilige (uniseriale) Fischflosse,
die sich von den Urfischen auf die übrigen Fische vererbt hat
(Fig. 408). •'
Wie aus dieser hälbgefiederten Fischflosse das fünfzehige Bein
der Amphibien (Fig. 409) entstanden ist, welches sich auf die drei
Amniotenklassen vererbte, hat uns erst Gegenbaur gelehrtllS). Es
sind nämlich bei denjenigen Dipneusten, welche die Stammeltern
der Amphibien wurden, auch die Flosseristrahlen an der anderen
Seite des Flossenstabes allmählich rückgebildet worden und größtenteils
verloren gegangen (die in Fig. 408 hell gehaltenen Knorpel).
Nur die vier untersten Flossenstrahlen (dunkel schraffiert) blieben
erhalten; und das sind die vier inneren Zehen des Fußes (erste
bis vierte Zehe). Die kleine oder fünfte Zehe hingegen entstand
aus dem unteren Ende des Flossenstabes. Aus dem mittleren und
oberen Teile des Flossenstabes entwickelte sich der lange Gliedmaßenstiel,
der als Unterschenkel (Fig. 409 r und u) und als
Oberschenkel (h) bei den höheren Wirbeltieren so bedeutend hervortritt.
[Vergl. zu Fig. 409' die Note 113 im Anhang.]
So entstand durch allmähliche Rückbildung und Differenzierung
aus der vielzehigen Fischflosse der fünf z ehig e Fuß der Amphibien,
den wir zuerst bei den karbonischen Stegocephalen (Fig. 314)
antreffen und der sich von da aus auf die R.eptihen einerseits, auf
die Säugetiere anderseits bis zum Menschen hinauf vererbt hat
(Fig. 411). Mit der Reduktion der Flossenstrahlen bis auf vier erfolgte
gleichzeitig die weitere Differenzierung des Flossenstabes, seine
quere Gliederung in obere und untere Schenkelhälften, und die Umbildung
des Gliedergürtels, der bei den höheren Wirbeltieren vorn
wie hinten ursprünglich aus drei Knochen zusammengesetzt ist. Es
zerfällt nämlich der einfache Bogen des ursprünglichen Schultergürtels
jederseits in ein oberes (dorsales) Stück, das Schulterblatt
{Scapula), und in ein unteres (ventrales) Stück: der vordere Teil
des letzteren bildet das Urschlüsselbein (Procoracoideum), der hintere
Teil das Rabenbein (Coracoideum). Ganz entsprechend sondert
sich auch der einfache Bogen des Beckengurtels in ein oberes (dorsales)
Stück, das Darmbein {Os ilium), und in ein unteres (ventrales)
Stück : der vordere Teil des letzteren bildet das Schambein
{Os pubis), der hintere das Sitzbein (Os ischii). Wie diese drei
Teile des Beckengürtels denjenigen des Schultergürtels entsprechen,
zeigt Ihnen die 48. Tabelle (S. 766). Der letztere besitzt jedoch
außerdem noch in dem sekundären Schlüsselbein (Clavicula) einen
vierten Knochen (ursprünglich Deckknochen der Haut), welcher dem
ersteren fehlt (Gegenbaur, Vergleichende Anatomie 1898, S. 467-^502).
Wie am Gürtel, so ist auch am Stiele der Gliedmaßen die
Uebereinstimmung zwichen der vorderen und hinteren Extremität
ursprünglich ganz vollständig. Der erste Abschnitt des Stieles wird
nur durch einen einzigen starken Knochen gestützt : vorn den Oberarm
{Humerus), hinten den Oberschenkel {Femur). Der zweite
Abschnitt enthält dagegen zwei Knochen : vorn Speiche {Radius, r)
und Ellbogen {Ulna, u); hinten entsprechend Schienbein {Tibia)
und Wadenbein {Fibula). (Vergl. die Skelette-Fig. 314, 319, 324,
_337,. 420.) Auch die darauf folgenden zahlreichen, kleinen
Knochen der Handwurzel {Carpus) und der E'ußwurzel {Tarsus)
sind vorn und hinten entsprechend angeordnet: ebenso die fünf
Knochen der Mittelhand {Metacarpus) und des Mittelfußes {Metatarsus).
Dasselbe gilt endlich auch von den daran angefügten fünf
Zehen selbst, die in ihrer charakteristischen Zusammensetzung aus
einer Reihe von Knochenstücken vorn und hinten ganz gleiche
Verhältnisse zeigen. Allé einzelnen Teile der Vorderbeine {Carpo-
mela) und der Hinterbeine (Tarsomela) zeigen Homodynamielu).