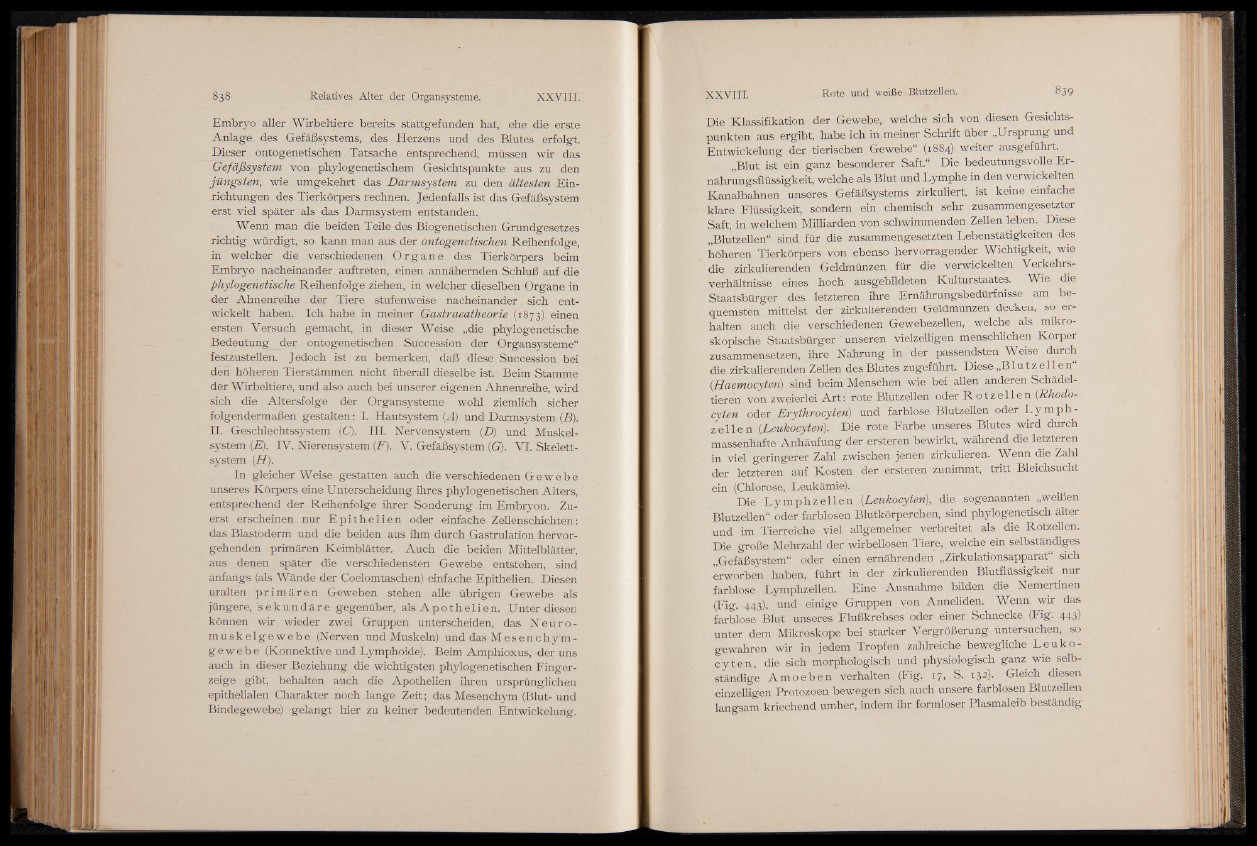
Embryo aller Wirbeltiere bereits stattgefunden hat, ehe die erste
Anlage des Gefäßsystems, des Herzens und des Blutes erfolgt.
Dieser ontogenetischen Tatsache entsprechend, müssen wir das
Gefäßsystem von phylogenetischem Gesichtspunkte aus zu den
jüngsten, wie umgekehrt das Darmsystem zu den ältesten Einrichtungen
des Tierkörpers rechnen. Jedenfalls ist das Gefäßsystem
erst viel später als das Darmsystem entstanden.
Wenn man die beiden Teile des Biogenetischen Grundgesetzes
richtig würdigt, so kann man aus der ontogenetischen Reihenfolge,
in welcher die verschiedenen Or g ane des Tierkörpers beim
Embryo nacheinander auftreten, einen annähernden Schluß auf die
phylogenetische Reihenfolge ziehen, in welcher dieselben Organe in
der Ahnenreihe der Tiere stufenweise nacheinander sich entwickelt
haben. Ich habe in meiner Gastraeatheorie (1873) einen
ersten Versuch gemacht, in dieser Weise „die phylogenetische
Bedeutung der ontogenetischen Succession der Organsysteme“
festzustellen. Jedoch ist zu bemerken, daß diese Succession bei
den höheren Tierstämmen nicht überall dieselbe ist. Beim Stamme
der Wirbeltiere, und also auch bei unserer eigenen Ahnenreihe, wird
sich die Altersfolge der Organsysteme wohl ziemlich sicher
folgendermaßen gestalten: I. Hautsystem (A) und Darmsystem (B).
II. Geschlechtssystem (C). III. Nervensystem (D) und Muskelsystem
(E). IV. Nierensystem (F). V. Gefäßsystem (G). VI. Skelettsystem
(H).
In gleicherweise gestatten auch die verschiedenen G e web e
unseres Körpers eine Unterscheidung ihres phylogenetischen Alters,
entsprechend der Reihenfolge ihrer Sonderung im Embryon. Zuerst
erscheinen nur Epi the l ien oder einfache Zellenschichten:
das Blastoderm und die beiden aus ihm durch Gastrulation hervorgehenden
primären Keimblätter. Auch die beiden Mittelblätter,
aus denen später die verschiedensten Gewebe entstehen, sind
anfangs (als Wände der Coelomtäschen) einfache Epithelien. Diesen
uralten primären Geweben stehen alle übrigen Gewebe als
jüngere, s ekundä r e gegenüber, al sApoth el ien. Unter diesen
können wir wieder zwei Gruppen unterscheiden, das Neuro-
mu s k e lg ewe b e (Nerven und Muskeln) und das Me senchym-
g e w e b e (Konnektive und Lymphoide). Beim Amphioxus, der uns
auch in dieser Beziehung die wichtigsten phylogenetischen Fingerzeige
gibt, behalten auch die Apothelien ihren ursprünglichen
epithelialen Charakter noch lange Zeit; das Mesenchym (Blut- und
Bindegewebe) -gelangt hier zu keiner bedeutenden Entwickelung.
Die Klassifikation der Gewebe,- welche sich von diesen Gesichtspunkten
aus ergibt, habe ich in meiner Schrift über „Ursprung und
Entwickelung der tierischen Gewebe“ (1884) weiter ausgeführt.
„Blut ist ein ganz besonderer Saft.“ Die bedeutungsvolle Er-
nährängsflüssigkeit, welche als Blut und Lymphe in den verwickelten
Kanalbahnen unseres Gefäßsystems zirkuliert, ist keine einfache
klare Flüssigkeit, sondern ein chemisch sehr zusammengesetzter
Saft, in welchem Milliarden von schwimmenden Zellen leben. Diese
„Blutzellen“ sind für die zusammengesetzten Lebenstätigkeiten des
höheren Tierkörpers von ebenso hervorragender Wichtigkeit, wie
die zirkulierenden Geldmünzen für die verwickelten Verkehrsverhältnisse
eines hoch ausgebildeten Kulturstaates. Wie die
Staatsbürger des letzteren ihre Ernährungsbedürfnisse am bequemsten
mittelst der zirkulierenden Geldmünzen decken, so erhalten
auch die verschiedenen Gewebezellen, welche als mikroskopische'
Staatsbürger ' unseren vielzelligen menschlichen Körper
züsammensetzen, ihre Nahrung in der passendsten Weise durch
die zirkulierenden Zellen des Blutes zugeführt. Diese „B1 u t z e 11 e n“
(Haemocyten) sind beim Menschen wie bei allen anderen Schädeltieren
von zweierlei Art: rote Blutzellen (»der K ot.ze 11 en [Lvhodo-
cyten oder Erythrocyten) und farblose Blutzellen oder Lymph-
z e i len (Leukocyten). Die rote Farbe unseres Blutes wird durch
massenhafte Anhäufung der ersteren bewirkt, während die letzteren
in viel geringerer Zahl zwischen jenen zirkulieren. Wenn die Zahl
der letzteren auf Kosten der ersteren zunimmt, tritt Bleichsucht
ein (Chlorose, Leukämie).
Die Lymphz e l len (Leukocyten), die sogenannten „weißen
Blutzellen“ oder farblosen Blutkörperchen, sind phylogenetisch älter
und im Tierreiche viel allgemeiner verbreitet als die Rotzellen.
Die große Mehrzahl der wirbellosen Tiere, welche ein selbständiges
„Gefäßsystem“ oder einen ernährenden „Zirkulationsapparat“ sich
erworben haben, führt in der zirkulierenden Blutflüssigkeit nur
farblose Lymphzellen. Eine Ausnahme bilden die Nemertinen
(Fig. 443), und einige Gruppen von Anneliden. Wenn wir das
farblose Blut unseres Flußkrebses oder einer Schnecke (Fig. 443)
unter dem Mikroskope bei starker Vergrößerung untersuchen, so
gewahren wir in jedem Tropfen zahlreiche bewegliche L e u k o cyten,
die sich morphologisch und physiologisch ganz wie selbständige
Arno eben verhalten (Fig. 17, S. 132). Gleich diesen
einzelligen Protozoen bewegen sich auch unsere farblosen Blutzellen
langsam kriechend umher, indem ihr formloser Plasmaleib beständig