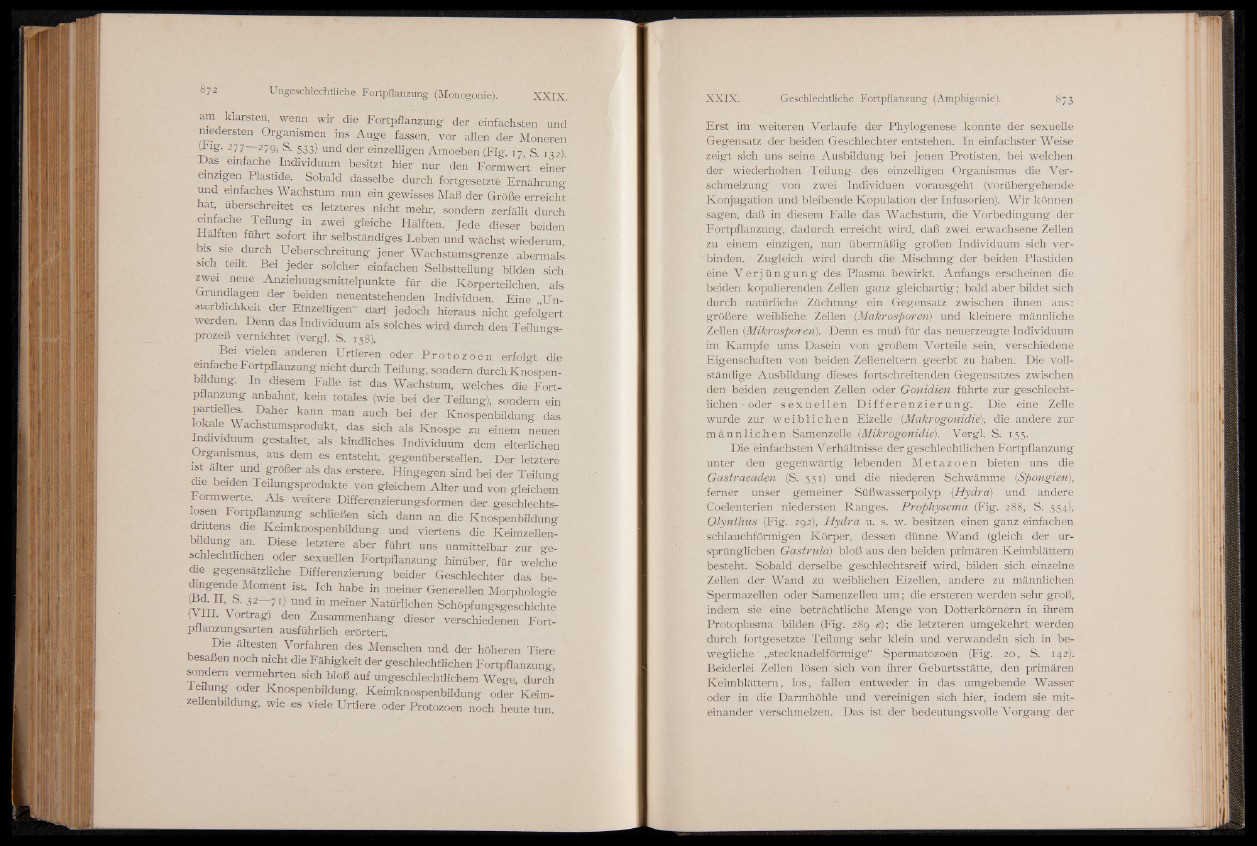
am klarsten, wenn wir die Fortpflanzung der einfachsten und
niedersten Organismen ins Auge fassen, vor allen der Moneren
(kig. 277 279, S. 533) und der einzelligen Amoeben (Fig. 17 S 132)
' Das einfache Individuum besitzt hier nur den Formwert einer
einzigen Plastide. Sobald dasselbe durch fortgesetzte Ernährung
und einfaches Wachstum nun ein gewisses Maß der Größe erreicht
hat, überschreitet es letzteres nicht mehr, sondern zerfällt durch
“ n; f he,T eilung in zwei gleiche Hälften. Jede dieser beiden
Hälften führt sofort ihr selbständiges Leben und wächst wiederum
bis sie durch Ueberschreitung jener Wachstumsgrenze abermals
sich teilt. Bei jeder solcher einfachen Selbstteilung bilden sich
zwei neue Anziehungsmittelpunkte für die Körperteilchen, als
Grundlagen der. beiden neuentstehenden Individuen. Eine „Unsterblichkeit
der Einzelligen“ darf jedoch hieraus nicht gefolgert
werden. Denn das Individuum als solches wird durch den Teilungs-
prozeß vernichtet (vergl. S. 158).
Bei vielen“ anderen Urtieren oder Protozoen erfolgt die
einfache Fortpflanzung nicht durch Teilung, sondern durch Knospen-
büdung. In diesem Falle ist das Wachstum, welches die Fortpflanzung
anbahnt, kein totales (wie bei der Teilung), sondern ein
partielles. Daher kann man auch bei der Knospenbildung das
lokale Wachstumsprodukt, das sich als Knospe zu einem neuen
Individuum gestaltet, als kindliches Individuum ' dem elterlichen
Urgamsmus, aus dem es entsteht, gegenüberstellen. Der letztere
ist alter und größer als das erstere. Hingegen sind bei der Teilung
die beiden Teilungsprodukte von gleichem Alter und von gleichem
ormwerte. Als weitere Differenzierungsformen der-geschlechtslosen
Fortpflanzung schließen sich dann an die Knospenbildung
drittens die Keimknospenbildung und viertens die Keimzellen-
büdung an. Diese letztere aber fuhrt uns unmittelbar zur geschlechtlichen
oder sexuellen Fortpflanzung hinüber, für welche
die gegensätzliche Differenzierung beider Geschlechter das ber
g e n d e Moment ist. Ich habe in meiner Generellen Morphologie
A7TTT \r ’ un(* 'm me*ner Natürlichen Schöpfungsgeschichte
(V1H. Vortrag) den Zusammenhang dieser verschiedenen Fort-
pxlanzungsarten ausführlich erörtert.
Die ältesten Vorfahren des Menschen und der höheren Tiere
besaßen noch nicht die Fähigkeit der geschlechtlichen Fortpflanzung,
sondern vermehrten sich bloß auf ungeschlechtlichem Wege, durch
?! Wg.„ 1° der Knospenbildung, Keimknospenbildung oder Keim-
zellenbildung, wie-es viele Urtiere oder Protozoen noch heute tun.
Erst im weiteren Verlaufe der Phylogenese konnte der sexuelle
Gegensatz der beiden Geschlechter entstehen. In einfachster Weise
zeigt sich uns seine Ausbildung bei jenen Protisten, bei welchen
der wiederholten Teilung des einzelligen Organismus die Verschmelzung
von zwei Individuen vorausgeht (vorübergehende
Konjugation und bleibende Kopulation der Infusorien). Wir können
sagen, daß in diesem Falle das Wachstum, die Vorbedingung der
Fortpflanzung, dadurch erreicht wird, daß zwei erwachsene Zellen
zu einem einzigen, nun übermäßig großen Individuum sich verbinden.
Zugleich wird durch die Mischung der beiden Plastiden
eine V e r jü n g u n g des Plasma bewirkt. Anfangs erscheinen die
beiden kopulierenden Zellen ganz gleichartig; bald aber bildet sich
durch natürliche Züchtung ein Gegensatz - zwischen ihnen aus:
größere weibliche. Zellen (Makrosporen) und kleinere männliche
Zellen (Mikrosporen). Denn es muß für das neuerzeugte Individuum
im, Kampfe ums Dasein, von großem Vorteile sein, verschiedene
Eigenschaften von beiden Zelleneltern geerbt zu haben. Die vollständige
Ausbildung dieses fortschreitenden Gegensatzes zwischen
den beiden zeugenden Zellen oder Gonidien führte zur geschlechtlichen
- oder s e xue l len Di f fe r enz ie rung . Die eine Zelle
wurde zur we ibl i chen Eizelle (Makrogonidie), die andere zur
männlLchen Samenzelle (Mikrogonidie).:- Vergl. S. 155.
Die “einfachsten Verhältnisse der geschlechtlichen Fortpflanzung
unter den gegenwärtig lebenden Metazoen bieten uns die
Gastraeaden (& 551) und die niederen Schwämme (Spongien),
ferner unser gemeiner Süßwasserpolyp [Hydra) und andere
Coelenterien niedersten Ranges. Prophysema (Fig. 288, S. 554),
Olynthus (Fig. 292), Hydra u. s. w. besitzen einen ganz einfachen
schlauchförmigen Körper, dessen dünne Wand (gleich der ursprünglichen
Gastrula) bloß aus den beiden primären Keimblättern
besteht. Sobald derselbe geschlechtsreif wird, bilden sich einzelne
Zellen der Wand zu weiblichen Eizellen, andere zu männlichen
Spermazellen oder Samenzellen um; die ersteren werden sehr groß,
indem sie eine beträchtliche Menge von Dotterkörnern in ihrem
Protoplasma bilden (Fig. 289 e); die letzteren umgekehrt werden
durch fortgesetzte Teilung sehr klein und verwandeln sich in bewegliche
„stecknadelförmige“ Spermatozoen (Fig. 20, S. 142).
Beiderlei Zellen lösen sich von ihrer Geburtsstätte, den primären
Keimblättern, los, fallen entweder in das umgebende Wasser
oder in die Darmhöhle und vereinigen sich hier, indem sie miteinander
verschmelzen. Das ist der bedeutungsvolle Vorgang der