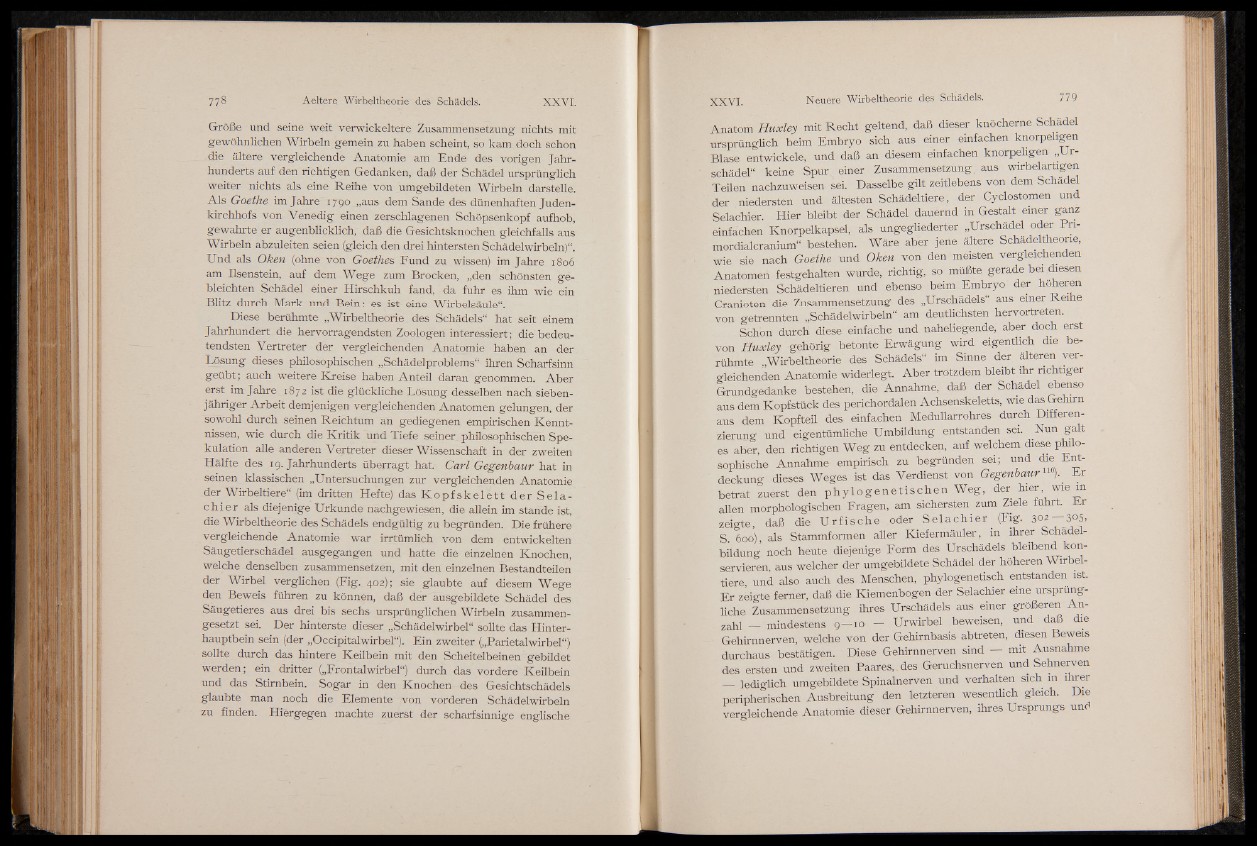
778 Aeltere Wirbeltheorie des Schädels. X X V I .
Größe und seine weit verwickeltere Zusammensetzung nichts mit
gewöhnlichen Wirbeln gemein zu haben scheint, so kam doch schon
die ältere vergleichende Anatomie am Ende des vorigen Jahrhunderts
auf den richtigen Gedanken, daß der Schädel ursprünglich
weiter nichts als eine Reihe von umgebildeten Wirbeln darstelle.
Als Goethe im Jahre 1 7 9 0 aus dem Sande des dünenhaften Judenkirchhofs
von Venedig einen zerschlagenen Schöpsenkopf aufhob,
gewahrte er augenblicklich, daß die Gesichtsknochen gleichfalls aus
Wirbeln abzuleiten seien (gleich den drei hintersten Schädelwirbeln)“.
Und als Oken (ohne' von Goethes Fund zu wissen) im Jahre 1806
am Ilsenstein, auf dem Wege zum Brocken, „den schönsten gebleichten
Schädel einer Hirschkuh fand, da fuhr es ihm wie ein
Blitz durch Mark und Bein: es ist eine Wirbelsäule“.
Diese berühmte „Wirbeltheorie des Schädels“ hat seit einpm
Jahrhundert die hervorragendsten Zoologen interessiert; die bedeutendsten
Vertreter der vergleichenden Anatomie haben an der
Lösung dieses philosophischen „Schädelproblems“ ihren Scharfsinn
geübt; auch weitere Kreise haben Anteil daran genommen. Aber
erst im Jahre 1872 ist die glückliche Lösung desselben nach siebenjähriger
Arbeit demjenigen vergleichenden Anatomen gelungen, der
sowohl durch seinen Reichtum an gediegenen empirischen Kenntnissen,
wie durch die Kritik und Tiefe seiner philosophischen Spekulation
alle anderen Vertreter dieser Wissenschaft in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts überragt hat.- Carl Gegenbaur hat in
seinen klassischen „Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie
der Wirbeltiere“ (im dritten Hefte) das K o p f s k e l e t t der Sela-
c hi er als diejenige Urkunde nachgewiesen, die allein im stände ist,
die Wirbeltheorie des Schädels endgültig zu begründen. Die frühere
vergleichende Anatomie war irrtümlich von dem entwickelten
Säugetierschädel ausgegangen und hatte die einzelnen Knochen,
welche denselben zusammensetzen, mit den einzelnen Bestandteilen
der Wirbel verglichen (Fig, 402); sie glaubte auf diesem Wege
den Beweis führen zu können, daß der ausgebildete Schädel des
Säugetieres aus drei bis sechs ursprünglichen Wirbeln zusammengesetzt
sei. Der hinterste dieser „Schädelwirbel“ sollte das Hinterhauptbein
sein (der „Occipitalwirbel“). Ein zweiter („Parietalwirbel“)
sollte durch das hintere Keilbein mit den Scheitelbeinen gebildet
werden; ein dritter („Frontalwirbel“) durch das vordere Keilbein
und das Stirnbein. Sogar in den Knochen des Gesichtschädels
glaubte man noch die Elemente ,von vorderen Schädelwirbeln
zu finden. Hiergegen machte zuerst der scharfsinnige englische
X X V I . Neuere Wirbeltheorie des Schädels. 779
Anatom Huxley mit Recht geltend, daß dieser knöcherne Schädel
ursprünglich beim Embryo sich aus einer einfachen knorpeligen
Blase entwickele, und daß an diesem einfachen knorpeligen „Ur-
schädel“ keine Spur, einer Zusammensetzung, aus wirbelartigen
Teilen nachzuweisen sei. Dasselbe gilt zeitlebens von dem Schädel
der niedersten und ältesten Schädeltiere , der Gyclostomen und
Selachier. Hier bleibt der Schädel dauernd in Gestalt einer ganz
einfachen Knorpelkapsel, als ungegliederter „Urschädel oder Pn-
mordialcranium“ bestehen. Wäre aber jene ältere Schädeltheorie,
wie sie nach Goethe und Oken von den meisten vergleichenden
Anatomen festgehalten wurde, richtig, so müßte gerade bei diesen
niedersten Schädeltieren und ebenso beim Embryo der höheren
Cranioten die Zusammensetzung des „Urschädels“ aus einer Re' e
von getrennten „Schädelwirbeln“ am deutlichsten hervortreten.
Schon durch diese einfache und naheliegende, aber doch erst
von Huxley gehörig betonte Erwägung wird eigentlich die berühmte
„Wirbeltheorie des Schädels“ im Sinne der älteren vergleichenden
Anatomie widerlegt. Aber trotzdem bleibt ihr richtiger
Grundgedanke bestehen, die Annahme, daß der Schädel ebenso
aus dem Kopfstück des perichordalen Achsenskeletts, wie das Gehirn
aus dem Kopfteil des einfachen Medullarrohres durch Differenzierung
und eigentümliche Umbildung entstanden sei. Nun galt
es aber, den richtigen Weg zu entdecken, auf welchem diese philosophische
Annahme empirisch zu begründen sei; und die Entdeckung
dieses Weges ist das Verdienst von Gegenbaur ■ Er
betrat zuerst den p h y l o g e n e t i s c h e n W e g, der hier wie m
allen morphologischen Fragen, am sichersten zum Ziele führt. Er
zeigte, daß die U r f i s c h e oder S e l a c h i e r (Fig. 302 — 305,
S. 600), als Stammformen aller Kiefermäuler, in ihrer Schäde -
bildung noch heute diejenige Form des Urschädels bleibend konservieren,
aus welcher der umgebildete Schädel der höheren W irbeltiere,
und also auch des Menschen, phylogenetisch entstanden ist.
Er zeigte ferner, daß die Kiemenbogen der Selachier eine ursprüngliche
Zusammensetzung ihres Urschädels aus einer größeren A n zahl
— mindestens 9—10 Urwirbel beweisen, und daß die
- Gehirnnerven, welche von der Gehirnbasis abtreten, diesen Beweis
durchaus bestätigen. Diese Gehirnnerven sind — mit Ausnahme
des ersten und zweiten Paares,.des Geruchsnerven und Sehnerven
_ lediglich umgebildete Spinalnerven und verhalten sich in ihrer
peripherischen Ausbreitung den letzteren wesentlich gleich. Die
vergleichende Anatomie dieser Gehirnnerven, ihres Ursprungs und