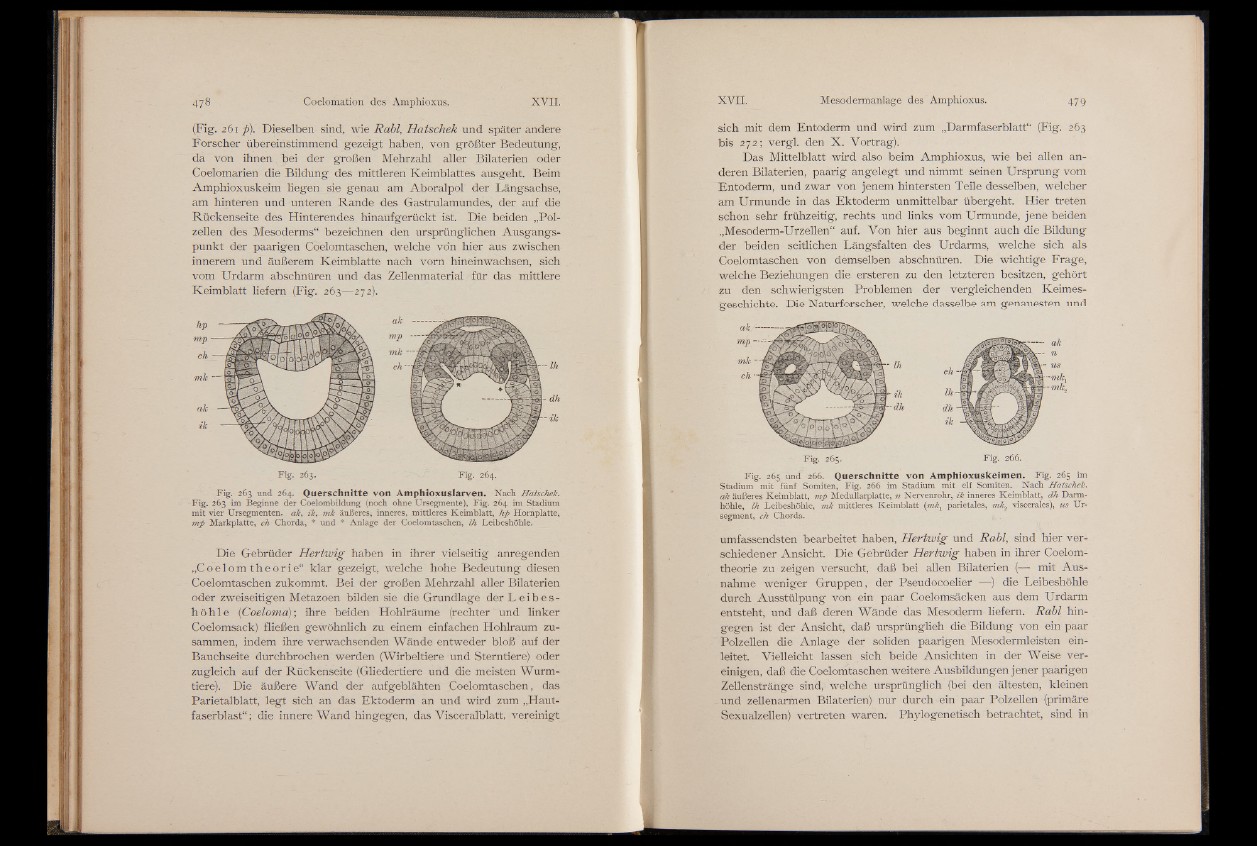
(Fig. 261 p). Dieselben sind, wie Rabl, Hatschek und später andere
Forscher übereinstimmend gezeigt haben, von größter Bedeutung,
da von ihnen bei der großen Mehrzahl aller Bilaterien oder
Coelomarien die Bildung des mittleren Keimblattes ausgeht. Beim
Amphioxuskeim liegen sie genau am Aboralpol der Längsachse,
am hinteren und unteren Rande des Gastrulamundes, der auf die
Rückenseite des Hinterendes hinaufgerückt ist. Die beiden „Polzellen
des Mesoderms“ bezeichnen den ursprünglichen Ausgangspunkt
der paarigen Coelomtaschen, welche von hier aus zwischen
innerem und äußerem Keimblatte nach vorn hineinwachsen, sich
vom Urdarm abschnüren und das Zellenmaterial für das mittlere
Keimblatt liefern (Fig. 263^272).
Fig. 264.
Fig. 263 und 264. Querschnitte von Amphioxuslarven. Nach Hatschek.
Fig. 263 im Beginne der Coelombildung (noch ohne Ursegmente), Fig. 264 im Stadium
mit vier Ursegmenten. ak, ik, mk äußeres; inneres, mittleres Keimblatt, hp Homplatte,
mp Markplatte, ch Chorda, * und * Anlage der Coelomtaschen, Ih Leibeshöhle.
Die Gebrüder Hertwig haben in ihrer vielseitig anregenden
„Coelom theor ie “ klar gezeigt, welche hohe Bedeutung diesen
Coelomtaschen zukommt. Bei der großen Mehrzahl aller Bilaterien
oder zweiseitigen Metazoen bilden sie die Grundlage der L e i b e s höhle
(Coeloma); ihre beiden Hohlräume (rechter und linker
Coelomsack) fließen gewöhnlich zu einem einfachen Hohlraum zusammen,
indem ihre verwachsenden Wände entweder bloß auf der
Bauchseite durchbrochen werden (Wirbeltiere und Sterntiere) oder
zugleich auf der Rückenseite (Gliedertiere und die meisten Wurmtiere).
Die äußere Wand der aufgeblähten Coelomtaschen, das
Parietalblatt, legt sich an das Ektoderm an und wird zum „Hautfaserblast“
; die innere Wand hingegen, das Visceralblatt, vereinigt
sich mit dem Entoderm und wird zum „Darmfaserblatt“ (Fig. 263
bis 272; vergl. den X. Vortrag).
Das Mittelblatt wird also beim Amphioxus, wie bei allen anderen
Bilaterien, paarig angelegt und nimmt seinen Ursprung vom
Entoderm, und zwar von jenem hintersten Teile desselben, welcher
am Urmunde in das Ektoderm unmittelbar übergeht. Hier treten
schon sehr frühzeitig, rechts und links vom Urmunde, jene beiden
„Mesoderm-Urzellen“ auf. Von hier aus beginnt auch die Bildung
der beiden seitlichen Längsfalten des Urdarms, welche sich als
Coelomtaschen von demselben abschnüren. Die wichtige Frage,
welche Beziehungen die ersteren zu den letzteren besitzen, gehört
zu den schwierigsten Problemen der vergleichenden Keimesgeschichte.
Die Naturforscher, welche dasselbe am genauesten und
Fig. 265.
ak
mp
mk
ch
Fig. 266.
Fig. 265 und 266. Querschnitte von Amphioxuskeimen. Fig. 265 im
Stadium mit fünf Somiten, Fig. 266 im Stadium mit elf Somiten. Nack Hatschek.
ak äußeres Keimblatt, mp Medullarplatte, n Nervenrohr, ik inneres Keimblatt, dh Darm-
böble, Ih Leibeshöhle, mk mittleres Keimblatt (mkt parietales, m \ viscerales), tts Ur-
segment, ch Chorda.
umfassendsten bearbeitet haben, Hertwig und Rabl, sind hier ver-
schieden er Ansicht. Die Gebrüder Hertwig haben in ihrer Coelom-
theorie zu zeigen versucht, daß bei allen Bilaterien (— mit Ausnahme
weniger Gruppen, der Pseudocoelier —-) die Leibeshöhle
durch Ausstülpung von ein paar Coelomsäcken aus dem Urdarm
entsteht, und daß deren Wände das Mesoderm liefern. Rabl hingegen
ist der Ansicht, daß ursprünglich die Bildung von ein paar
Polzellen die Anlage der soliden paarigen Mesodermleisten einleitet.
Vielleicht lassen sich beide Ansichten in der Weise vereinigen,
daß die Coelomtaschen weitere Ausbildungen jener paarigen
Zellenstränge sind, welche ursprünglich (bei den ältesten, kleinen
und zellenarmen Bilaterien) nur durch ein paar Polzellen (primäre
Sexualzellen) vertreten waren. Phylogenetisch betrachtet, sind in