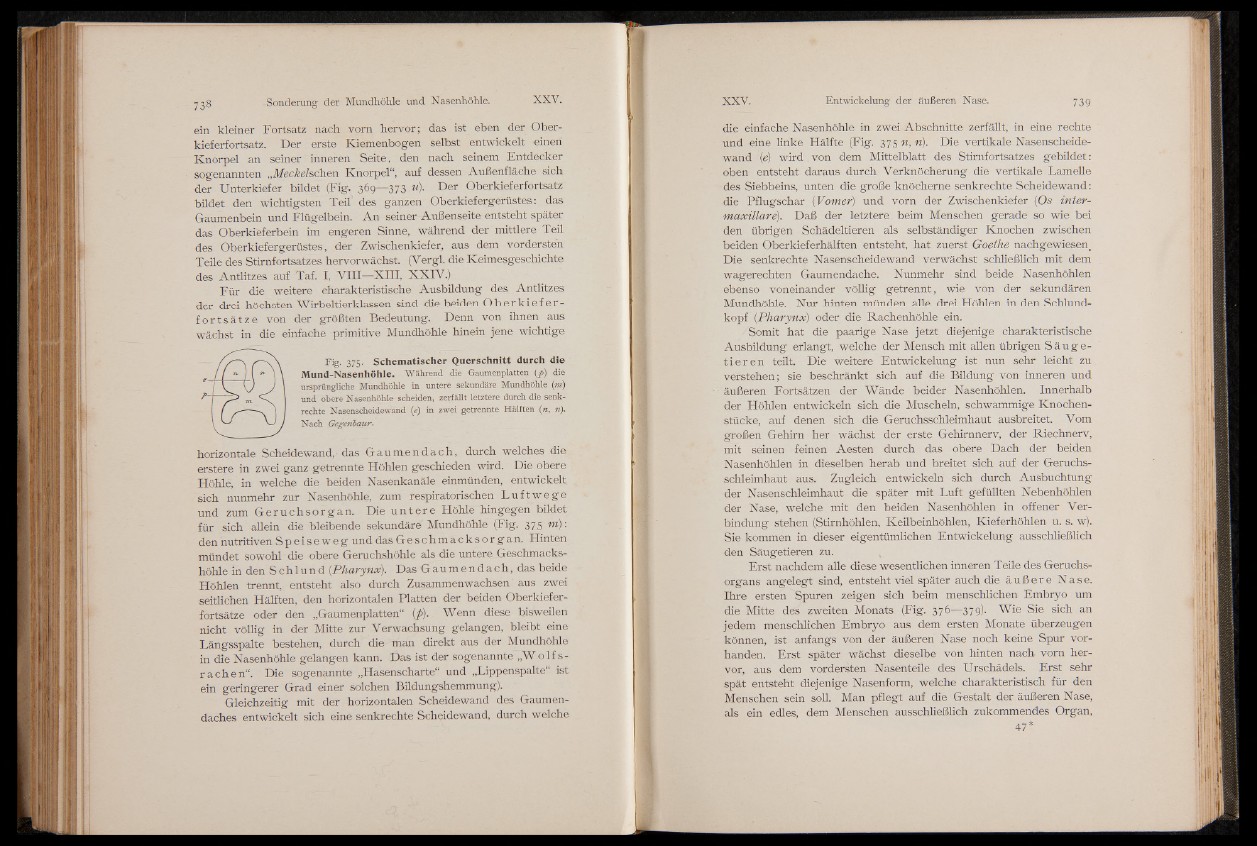
ein kleiner Fortsatz nach vorn hervor; das ist eben der Oberkieferfortsatz.
Der erste Kiemenbogen selbst entwickelt einen
Knorpel an seiner inneren Seite, den nach seinem Entdecker
sogenannten „Meckelsclaen Knorpel“, auf dessen Außenfläche sich
der Unterkiefer bildet (Fig, 309— 373 «)• Der Oberkieferfortsatz
bildet den wichtigsten Teil' des ganzen Oberkiefergerüstes: das
Gaumenbein und Flügelbein. An seiner Außenseite entsteht später
das Oberkieferbein im engeren Sinne, während der mittlere Teil
des Oberkiefergerüstes, der Zwischenkiefer, aus dem vordersten
Teile des Stimfortsatzes hervorwächst. (Vergl. die Keimesgeschichte
des Antlitzes auf Taf. I, VIII—XIII, XXIV.)
Für die weitere charakteristische Ausbildung des Antlitzes
der drei höchsten Wirbeltierklassen sind die beiden Ober ki e f er -
for t sä t z e von der größten Bedeutung. Denn von ihnen aus
wächst in die einfache primitive Mundhöhle hinein jene wichtige
Fig. 375. S ch em a tis ch e r Q u e rs ch n itt durch die
Mund-Nasenhöhle. Während die Gaumenplatten {J>) die
ursprüngliche Mundhöhle in untere sekundäre Mundhöhle (m)
und obere Nasenhöhle scheiden, zerfällt letztere durch die senkrechte
Nasenscbeidewand (e) in zwei getrennte Hälften («, n).
Nach Gegeribaur.
horizontale Scheidewand, ■ das G a u me n d a c h , durch welches die
erstere in zwei ganz getrennte Höhlen geschieden wird. Die obere
Höhle, in welche die beiden Nasenkanäle einmünden, entwickelt
sich nunmehr zur Nasenhöhle, zum respiratorischen L u f twe g e
und zum Geruchsorgan. Die unte re Höhle hingegen bildet
für sich allein die bleibende sekundäre Mundhöhle (Fig. 375 m):
den nutritiven Spe is ew eg und das Ge s chmacksorgan. Hinten
mündet sowohl die obere Geruchshöhle als die untere Geschmackshöhle
in den Schlund (Pharynx). Das Gaumendach, das beide
Höhlen trennt, entsteht also durch Zusammenwachsen' aus zwei
seitlichen Hälften, den horizontalen Platten der beiden Oberkieferfortsätze
oder den „Gaumenplatten“ (p). Wenn diese bisweilen
nicht völlig in der Mitte zur Verwachsung gelangen, bleibt eine
Längsspalte bestehen, durch die man direkt aus der Mundhöhle
in die Nasenhöhle gelangen kann. Das ist der sogenannte „Wolf s-
rachen“. Die sogenannte „Hasenscharte“ und „Lippenspalte“ ist
ein geringerer Grad einer solchen Bildungshemmung).
Gleichzeitig mit der horizontalen Scheidewand des Gaumendaches
entwickelt sich eine senkrechte Scheidewand, durch welche
die einfache Nasenhöhle in zwei Abschnitte zerfällt, in eine rechte
und eine linke Hälfte (Fig. 375 n, n). Die vertikale Nasenscheidewand
(e) wird von dem Mittelblatt des Stirnfortsatzes gebildet:
oben entsteht daraus durch Verknöcherung die vertikale Lamelle
des Siebbeins, unten die große knöcherne senkrechte Scheidewand:
die Pflugschar (Vomer) und vorn der Zwischenkiefer (Os intermaxillare).
Daß der letztere beim Menschen gerade so wie bei
den übrigen Schädel deren als selbständiger Knochen zwischen
beiden Oberkieferhälften entsteht, hat zuerst Goethe nachgewiesen.
Die senkrechte Nasenscheidewand verwächst schließlich mit dem
wagerechten Gaumendache. Nunmehr sind beide Nasenhöhlen
ebenso voneinander völlig getrennt, wie von der sekundären
Mundhöhle. Nur hinten münden alle drei Höhlen in den Schlundkopf
(Pharynx) oder die Rachenhöhle ein.
Somit hat die paarige Nase jetzt diejenige charakteristische
Ausbildung erlangt, welche der Mensch mit allen übrigen S ä u g e t
i eren teilt Die weitere Entwickelung ist nun sehr leicht zu
verstehen; sie beschränkt sich auf die Bildung von inneren und
äußeren Fortsätzen der Wände beider Nasenhöhlen. Innerhalb
der Höhlen entwickeln sich die Muscheln, schwammige Knochenstücke,
auf denen sich die Geruchsschleimhaut ausbreitet. Vom
großen Gehirn her wächst der erste Gehirnnerv, der Riechnerv,
mit seinen feinen Aesten durch das obere Dach der beiden
Nasenhöhlen in dieselben herab und breitet sich auf der Geruchs-
schleimhaüt aus. Zugleich entwickeln sich durch Ausbuchtung
der Nasenschleimhaut die später mit Luft gefüllten Nebenhöhlen
der Nase, welche mit den beiden Nasenhöhlen in offener Verbindung
stehen (Stirnhöhlen, Keilbeinhöhlen, Kieferhöhlen u. s. w).
Sie kommen in dieser eigentümlichen Entwickelung ausschließlich
den Säugetieren zu.
Erst nachdem alle diese wesentlichen inneren Teile des Geruchsorgans
angelegt sind, entsteht viel später auch die äußere Nase.
Ihre ersten Spuren zeigen sich beim menschlichen Embryo um
die Mitte des zweiten Monats (Fig. 376—379)- Wie Sie sich an
jedem menschlichen Embryo aus dem ersten Monate überzeugen
können, ist anfangs von der äußeren Nase noch keine Spur vorhanden.
Erst später wächst dieselbe von hinten nach vorn hervor,
aus dem vordersten Nasenteile des Urschädels. Erst sehr
spät entsteht diejenige Nasenform, welche charakteristisch für den
Menschen sein soll. Man pflegt auf die Gestalt der äußeren Nase,
als ein edles, dem Menschen ausschließlich zukommendes Organ,