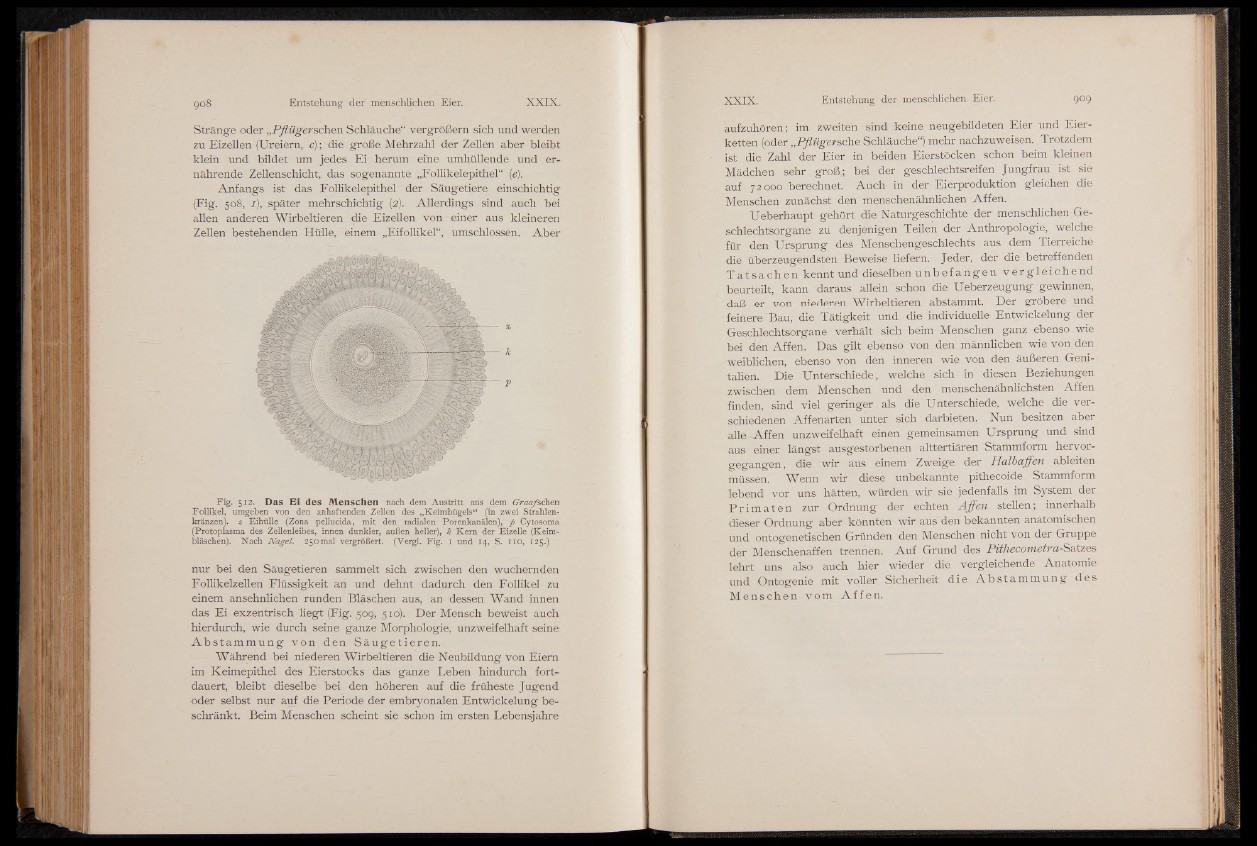
Stränge oder „Pßügerschen Schläuche“ vergrößern sich und werden
zu Eizellen (Ureiern, c); die große Mehrzahl der Zellen aber bleibt
klein und bildet um jedes Ei herum eine umhüllende und ernährende
Zellenschicht, das sogenannte „Follikelepithel“ (e).
Anfangs ist das Follikelepithel der Säugetiere einschichtig
(Fig. 508, 1), später mehrschichtig (2). Allerdings sind auch bei
allen anderen Wirbeltieren die Eizellen von einer aus kleineren
Zellen bestehenden Hülle, einem „Eifollikel“, umschlossen. Aber
Fig. 512. Das Ei des Menschen nach dem Austritt aus dem Graafschem
Follikel, umgeben von den anhaftenden Zellen des „Keimhügels“ (in zwei Strahlenkränzen).
z Eihülle (Zona pellucida, mit den radialen Porenkanälen), ƒ Cytosoma.
(Protoplasma des Zellenleibes, innen dunkler, außen heller), k Kern der Eizelle (Keimbläschen).
Nach Nagel. 250 mal vergrößert. (Vergl. Fig. 1 und 14, S. 110, 125.)
nur bei den Säugetieren sammelt sich zwischen den wuchernden
Follikelzellen Flüssigkeit an und dehnt dadurch den Follikel zu
einem ansehnlichen runden Bläschen aus, an dessen Wand innen
das Ei exzentrisch liegt (Fig. 509, 510). Der Mensch beweist auch
hierdurch, wie durch seine ganze Morphologie, unzweifelhaft seine
Ab s t ammu n g von den Säuget ieren.
Während bei niederen Wirbeltieren die Neubildung von Eiern
im Keimepithel des Eierstocks das ganze Leben hindurch fortdauert,
bleibt dieselbe bei den höheren auf die früheste Jugend
oder selbst nur auf die Periode der embryonalen Entwickelung beschränkt.
Beim Menschen scheint sie schon im ersten Lebensjahre
aufzuhören; im zweiten sind keine neugebildeten Eier und Eierketten
(oder „Pflügersche Schläuche“) mehr nachzuweisen. Trotzdem
ist die Zahl der Eier in beiden Eierstöcken schon beim kleinen
Mädchen sehr groß,; bei der geschlechtsreifen Jungfrau ist sie
auf- 72000 berechnet. Auch in der Eierproduktion gleichen die
Menschen zunächst den menschenähnlichen Affen.
Ueberhaupt gehört die Naturgeschichte der menschlichen Geschlechtsorgane
zu denjenigen Teilen der Anthropologie, welche
für den Ursprung des Menschengeschlechts aus dem Tierreiche
die überzeugendsten Beweise liefern. Jeder, der die betreffenden
Ta t s a chen kennt und dieselben unbe fang en v e rg le i ch end
beurteilt, kann daraus allein schon die Ueberzeugung gewinnen,
daß er von niederen Wirbeltieren abstammt. Der gröbere und
feinere Bau, die Tätigkeit und die individuelle Entwickelung der
Geschlechtsorgane verhält sich beim Menschen ganz ebenso wie
bei den Affen. Das gilt ebenso von den männlichen wie von den
weiblichen, ebenso von den inneren wie von den äußeren Genitalien.
Die Unterschiede, welche sich in diesen Beziehungen
zwischen dem Menschen und den menschenähnlichsten Affen
finden, sind viel geringer als die Unterschiede, welche die verschiedenen
Affenarten unter sich darbieten. Nun besitzen aber
alle-Affen unzweifelhaft einen gemeinsamen Ursprung und sind
aus 'einer längst ausgestorbenen alttertiären Stammform hervorgegangen,
die wir aus einem Zweige der Halbaffen ableiten
müssen. Wenn wir diese unbekannte pithecoide Stammform
lebend vor uns hätten, würden wir sie jedenfalls im System der
Pr imaten zur Ordnung der echten Affen stehen; innerhalb
dieser Ordnung aber könnten wir aus den bekannten anatomischen
und ontogenetischen Gründen den Menschen nicht von der Gruppe
der Menschenaffen trennen. Auf Grund des Pithecometra-Sa-tzes
lehrt uns also auch hier wieder die vergleichende Anatomie
und Ontogenie mit voller Sicherheit d ie Ab s t ammung des
Menschen vom Af fen.