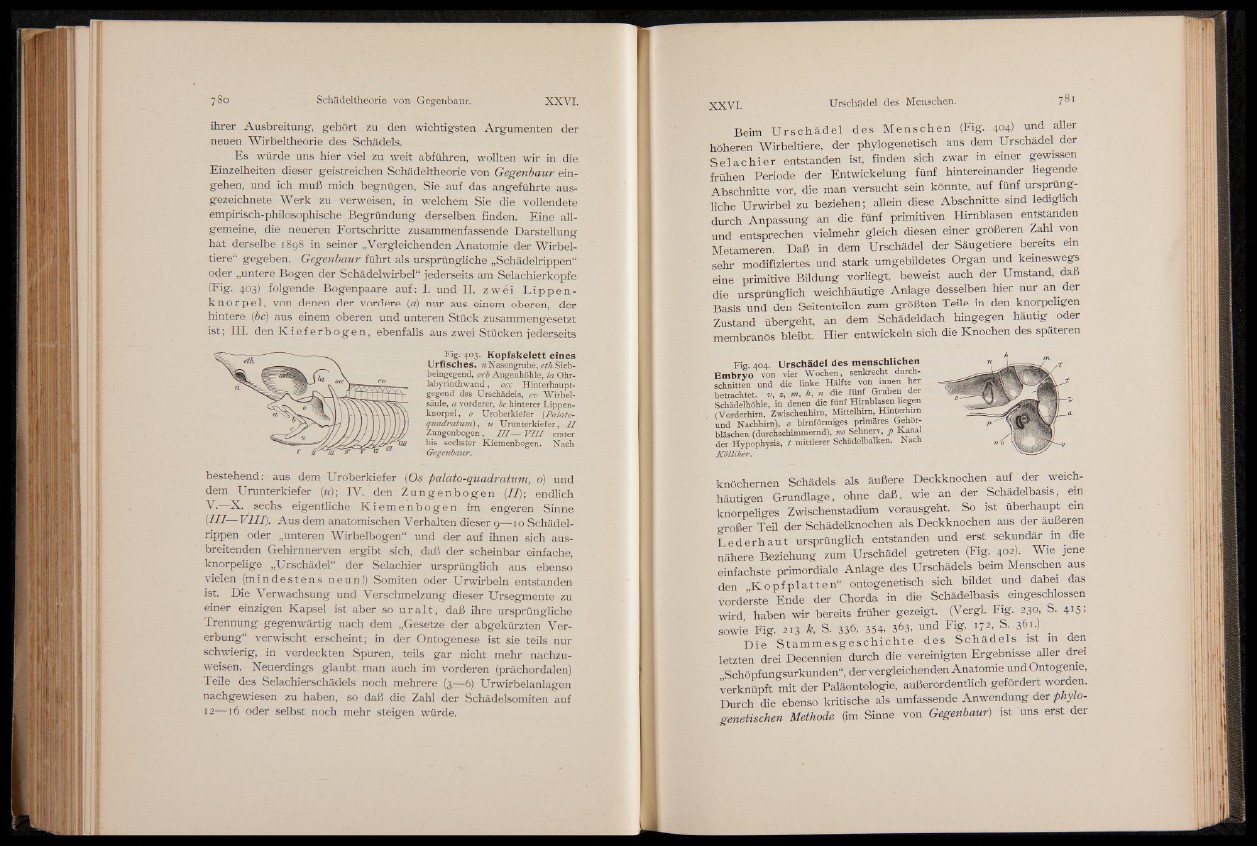
ihrer Ausbreitung, gehört zu den wichtigsten Argumenten der
neuen Wirbeltheorie des Schädels.
Es würde uns hier viel zu weit abführen, wollten wir in die
Einzelheiten dieser geistreichen Schädeltheorie von Gegenbaur ein-
gehen, und ich muß mich begnügen, Sie auf das angeführte ausgezeichnete
Werk zu verweisen, in welchem Sie die vollendete
empirisch-philosophische Begründung derselben finden. Eine allgemeine,
die neueren Fortschritte zusammenfassende Darstellung
hat derselbe 1898 in seiner „Vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere“
gegeben. Gegenbaur führt als ursprüngliche „Schädelrippen“
oder „untere Bogen der Schädelwirbel“ jederseits am Selachierkopfe
(Fig. 403) folgende Bogenpaare auf: jgj und II. zwei L ip p e n knorpe
l , von denen der vordere (a) nur aus einem oberen, der
hintere (bc) aus einem oberen und unteren Stück zusammengesetzt
ist; III. den K i e f er bogen, ebenfalls aus zwei Stücken jederseits
Fig. 403. Kopfskelett eines
Urfisches. «Nasengrube, ^ÄfcSieb-
beingegend, orb Augenhöhle, la Ohrlabyrinthwand
, occ Hinterhauptgegend
des Urschädels, cv Wirbelsäule,
a vorderer, bc hinterer Lippenknorpel
, 0 Uroberkiefer (Palato-
quadraturri) , u Urunterkiefer, I I
Zungenbogen, I I I -— V III erster
bis sechster Kiemenbogen. Nach
Gegenbaur.
bestehend: aus dem Uroberkiefer (Os palato-quadratum, o) und
dem Urunterkiefer (u); IV. den Zung enbo g en (II); endlich
V.—X. sechs eigentliche Ki eme n b o g e n im engeren Sinne
(III— VIII). Aus dem anatomischen Verhalten dieser 9— 10 Schädelrippen
oder „unteren Wirbelbogen“ und der auf ihnen sich ausbreitenden
Gehirnnerven ergibt sich, daß der scheinbar einfache,
knorpelige „Urschädel“ der Selachier ursprünglich aus ebenso
vielen (mindestens neun!) Somiten oder Urwirbeln entstanden
ist. Die Verwachsung und Verschmelzung dieser Ursegmente zu
einer einzigen Kapsel ist aber so ural t , daß ihre ursprüngliche
Trennung gegenwärtig nach dem „Gesetze der abgekürzten Vererbung“
verwischt erscheint; in der Ontogenese ist sie teils nur
schwierig, in verdeckten Spuren, teils gar nicht mehr nachzuweisen.
Neuerdings glaubt man auch im vorderen (prächordalen)
Teile des Selachierschädels noch mehrere (3— 6) Urwirbelanlagen
nachgewiesen zu haben, so daß die Zahl der Schädelsomiten auf
12— 16 oder selbst noch mehr steigen würde.
Beim Ur s chäd e l des Menschen (Fig. 404) und aller
höheren Wirbeltiere, der phylogenetisch aus dem Urschädel der
Se la chie r entstanden ist, finden sich zwar in einer gewissen
frühen Periode der Entwickelung fünf hintereinander liegende
Abschnitte vor, die man versucht sein könnte, auf fünf ursprüngliche
Urwirbel zu beziehen; allein diese Abschnitte, sind lediglic
durch Anpassung an die fünf primitiven Hirnblasen entstanden
und entsprechen vielmehr gleich diesen einer größeren Zahl von
Metameren. Daß in dem Urschädel der Säugetiere bereits ein
sehr modifiziertes und stark umgebildetes Organ und keineswegs
eine primitive Bildung vorliegt, beweist auch der Umstand, daß
die ursprünglich weichhäutige Anlage desselben hier nur an der
Basis und den Seitenteilen zum größten Teile in den knorpeligen
Zustand übergeht, an dem Schädeldach hingegen häutig oder
membranös bleibt. Hier entwickeln sich die Knochen des späteren
Fig. 404. Urschädel des menschlichen
Embryo von vier Wochen, senkrecht durchschnitten
und die linke Hälfte von innen her
betrachtet, w, z, m, h, n die fünf Gruben der
Schädelhöhle, in denen die fünf Hirnblasen liefen
(Vorderhim, Zwischenhim, Mittelhim, Hinterhim
und Nachhim), o bimförmiges primäres Gehor-
bläschen (durchschimmernd), no Sehnerv, $ Kanal
der Hypophysis, t mittlerer Schädelbalken. Nach
K ö lliker.
knöchernen Schädels als äußere Deckknochen auf der weichhäutigen
Grundlage, ohne daß, wie an der Schädelbasis, ein
knorpeliges Zwischenstadium vorausgeht. So ist überhaupt ein
großer Teil der Schädelknochen als Deckknochen aus der äußeren
Lede rhaut ursprünglich entstanden und erst sekundär in die
nähere Beziehung zum Urschädel getreten (Fig. 402). Wie jene
einfachste primordiale Anlage des Urschädels beim Menschen aus
den K o p f plat ten“ ontogenetisch sich bildet und dabei das
vorderste Ende der Chorda in die Schädelbasis eingeschossen
wird haben wir bereits früher gezeigt. (Vergl. Fig. 230, S. 415;
sowie Fig. 213 f l S. 336, 354, 363, und Fig. 172, S 361.)
D ie S t amme s g e s chi cht e des Schäde l s ist in en
letzten drei Decennien durch die vereinigten Ergebnisse aller drei
Schöpfungsurkunden“, der vergleichenden Anatomie und Ontogeme,
verknüpft mit der Paläontologie, außerordentlich gefördert worden.
Durch die ebenso kritische als umfassende Anwendung der phylogenetischen
Methode (im Sinne von Gegenbaur) ist uns erst der