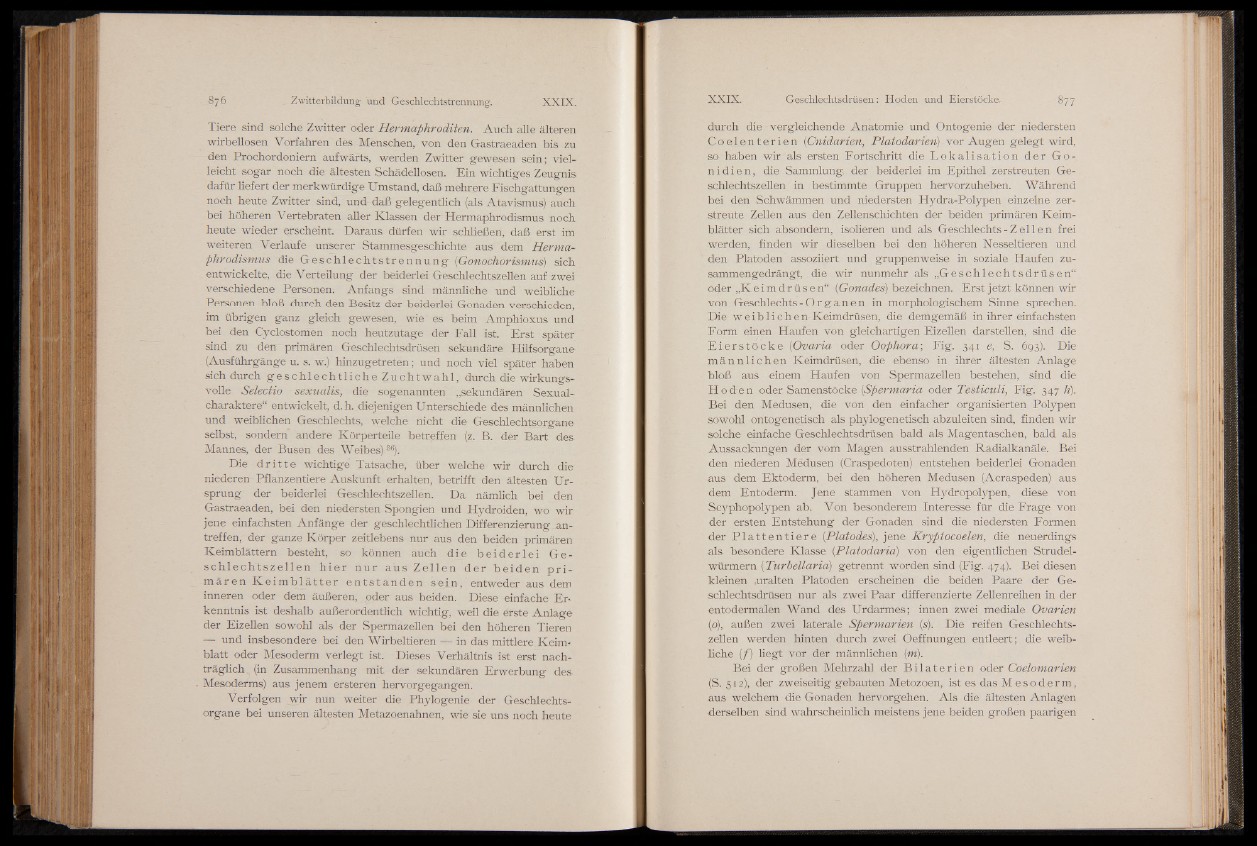
Tiere sind solche Zwitter oder Hermaphroditen. Auch alle älteren
wirbellosen Vorfahren des Menschen, von den Gastraeaden bis zu
den Prochordoniern aufwärts, werden Zwitter gewesen sein; vielleicht
sogar noch die ältesten Schädellosen. Ein wichtiges Zeugnis
dafür liefert der merkwürdige Umstand, daß mehrere Fischgattungen
noch heute Zwitter sind, und- daß gelegentlich (als Atavismus) auch
bei höheren Vertebraten aller Klassen der Hermaphrodismus noch
heute wieder erscheint. Daraus dürfen wir schließen, daß erst im
weiteren Verlaufe unserer Stammesgeschichte aus dem Herma-
phrodismns die Ge s chl e cht s t r ennung (Gonochorismus) sich
entwickelte, die Verteilung der beiderlei Geschlechtszellen auf zwei
verschiedene Personen. Anfangs sind männliche und weibliche
Personen bloß durch den Besitz der beiderlei Gonaden verschieden,
im übrigen ganz gleich gewesen, wie es beim Amphioxus und
bei den Cyclostomen noch heutzutage der Fall ist. Erst später
sind zu den-primären Geschlechtsdrüsen sekundäre Hilfsorgane
(Ausführgänge u. s. w.) hinzugetreten; und noch viel später haben
sich durch g e s c h l e c h t l i ch e Zuchtwah 1, durch die wirkungsvolle
Selectio -sexualis, die sogenannten „sekundären Sexualcharaktere“
entwickelt, d.h. diejenigen Unterschiede des männlichen
und weiblichen Geschlechts, welche nicht die Geschlechtsorgane
selbst, sondern andere Körperteile betreffen (z. B. der Bart des
Mannes, der Busen des Weibes) 36).
Die dr i t te wichtige Tatsache, über welche wir durch die
niederen- Pflanzentiere Auskunft erhalten, betrifft den ältesten Ursprung
der beiderlei Geschlechtszellen. Da nämlich bei den
Gastraeaden, bei den niedersten Spongien und Hydroiden, wo wir
jene einfachsten Anfänge der geschlechtlichen Differenzierung antreffen,
der ganze Körper zeitlebens nur aus den beiden primären
Keimblättern besteht, so können auch die be ide r le i Ge s
chl e cht s z e l l en hier nur aus Zel len der beiden p r i mären
Ke imb l ä t t e r ent s tanden sein, entweder aus dem
inneren oder dem äußeren, .„oder aus beiden. Diese einfache Erkenntnis
ist deshalb außerordentlich wichtig, weil die erste Anlage
der Eizellen sowohl als der Spermäzellen bei den höheren Tieren
—- und insbesondere bei den Wirbeltieren — in das mittlere Keimblatt
oder Mesoderm verlegt ist. Dieses Verhältnis ist erst nachträglich
(in Zusammenhang mit der sekundären Erwerbung des
Mesoderms) aus jenem ersteren hervorgegangen.
Verfolgen wir nun weiter die Phylogenie der Geschlechtsorgane
bei unseren ältesten Metazoenahnen, wie sie uns noch heute
durch die vergleichende Anatomie und Ontogenie der niedersten
Coe l ente r ien (Cnidarien, Platodarien) vor Augen gelegt wird,
so haben wir als ersten Fortschritt die Lo k a l i s a t ion der G o tt
i dien, die Sammlung der beiderlei im Epithel zerstreuten Geschlechtszellen
in bestimmte Gruppen hervorzuheben. Während
bei den Schwämmen und niedersten Hydra-Polypen einzelne zerstreute
Zellen aus den Zellenschichten der beiden primären Keimblätter
sich absondern, isolieren und als Geschlechts-Zellen frei
werden, finden wir dieselben bei den höheren Nesseltieren und
den Platoden assoziiert und gruppenweise in soziale Haufen zusammengedrängt,
die wir nunmehr als „Ge s chle cht sdrüsen“
oder „Keimdrüsen“ (Gonades) bezeichnen. Erst jetzt können wir
von Geschlechts - O r g a n e n in morphologischem Sinne sprechen.
Die weiblichen-Keimdrüsen, die demgemäß in ihrer einfachsten
Form einen Haufen von gleichartigen Eizellen darstellen, sind die
Eie r s t ö c k e (Ovaria oder Oophora\ Fig. 341 e, S. 693).. Die
männl i chen Keimdrüsen, die ebenso in ihrer ältesten Anlage
bloß aus einem Haufen von Spermazellen bestehen, sind die
H oden oder Samenstöcke (Spermaria oder Testiculi, Fig. 347 h).
Bei den Medusen, die von den einfacher organisierten Polypen
sowohl ontogenetisch als phylogenetisch abzuleiten sind, finden wir
solche einfache Geschlechtsdrüsen bald als Magentaschen, bald als
Aussackungen der vom Magen ausstrahlenden Radialkanäle. Bei
den niederen Medusen (Craspedoten) entstehen beiderlei Gonaden
aus dem Ektoderm, bei den höheren Medusen (Acraspeden) aus
dem Entoderm. Jene stammen von Hydropolypen, diese von
Scyphopolypen ab. Von besonderem Interesse für die Frage von
der ersten Entstehung der Gonaden sind die niedersten Formen
der Pla t t ent ie r e {Platodes), jene Kryptocoelen, die neuerdings
als besondere Klasse (Platodaria) von den eigentlichen Strudelwürmern
(Turbellaria:) getrennt worden sind (Fig. 474).. Bei diesen
kleinen .uralten Platoden erscheinen die beiden Paare der Geschlechtsdrüsen
nur als zwei Paar differenzierte Zellenreihen in der
entodermalen Wand des Urdarmes; innen zwei mediale Ovarien
(i0), außen zwei laterale Spermarien (s). Die reifen Geschlechtszellen
werden hinten durch zwei Oeffnungen entleert; die weibliche
(f ) liegt vor der männlichen (m).
Bei der großen Mehrzahl der Bi la te r ien oder Coelomarien
(S. 512), der zweiseitig gebauten Metozoen, ist es das Mesoderm,
aus welchem die Gonaden hervorgehen. Als die ältesten Anlagen
derselben sind wahrscheinlich meistens jene beiden großen paarigen