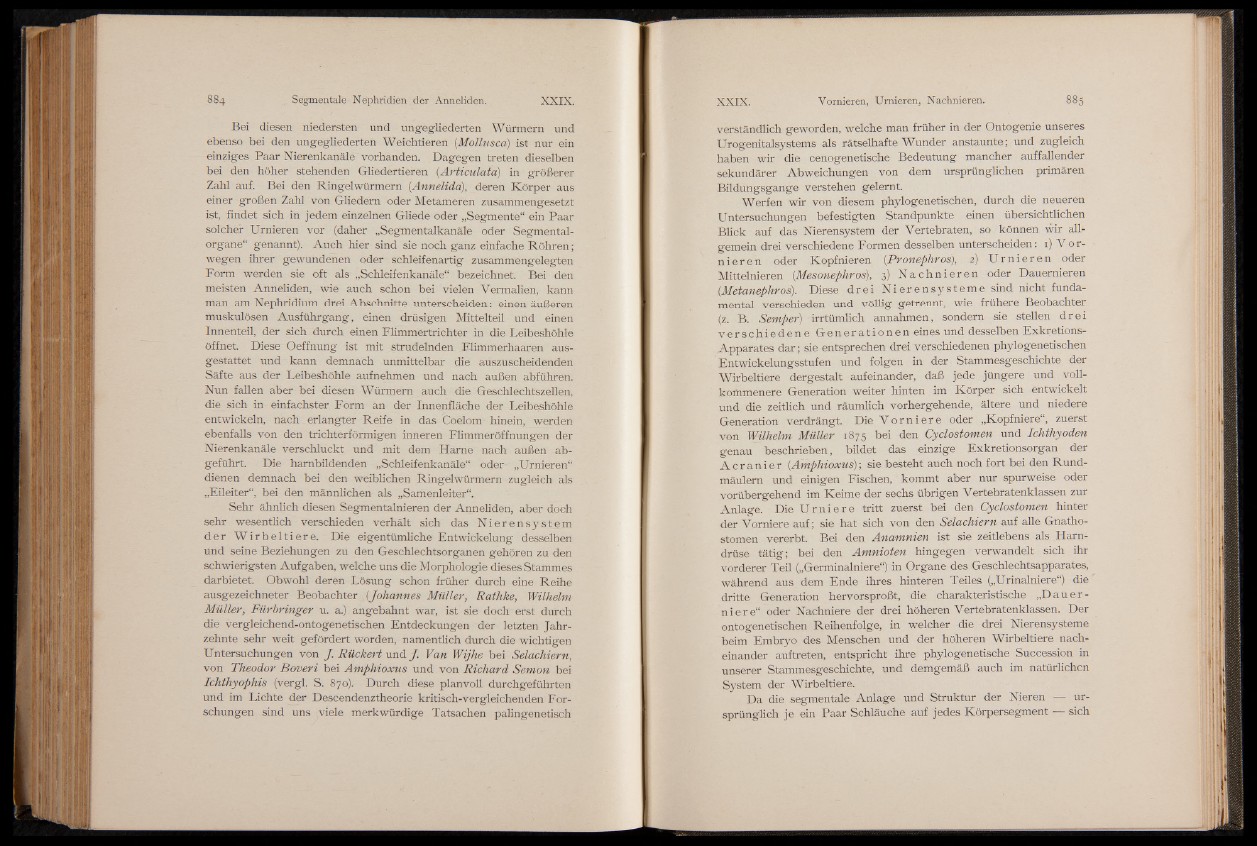
Bei diesen niedersten und ungegliederten Würmern und
ebenso bei den ungegliederten Weichtieren (Mollusca) ist nur ein
einziges Paar Nierenkanäle vorhanden. . Dagegen treten dieselben
bei den höher stehenden Gliedertieren (Articulata) in größerer
Zahl auf. Bei den Ringelwürmern (Annelida), deren Körper aus
einer großen Zahl von Gliedern oder Metameren zusammengesetzt
ist, findet sich in jedem einzelnen Gliede oder „Segmente“ ein Paar
solcher Urnieren vor (daher „Segmentalkanäle oder Segmental-
organe“ genannt). Auch hier sind sie noch ganz einfache Röhren;
wegen ihrer gewundenen oder schleifenartig zusammengelegten
Form werden sie oft als „Schleifenkanäle“ bezeichnet. Bei den
meisten Anneliden, wie auch schon bei vielen Vermalien, kann
man am Nephridium drei Abschnitte unterscheiden: einen äußeren
muskulösen Ausführgang, einen drüsigen Mittelteil und einen
Innenteil, der sich durch einen Flimmertrichter in die Leibeshöhle
öffnet Diese Oeffnung ist mit strudelnden Flimmerhaaren ausgestattet
und kann demnach unmittelbar die auszuscheidenden
Säfte aus der Leibeshöhle aufnehmen und nach außen abführen.
Nun fallen aber bei diesen Würmern auch die Geschlechtszellen,
die sich in einfachster Form an der Innenfläche der Leibeshöhle
entwickeln, nach erlangter Reife in das Coelom hinein, werden
ebenfalls von den trichterförmigen inneren Flimmeröffnungen der
Nierenkanäle verschluckt und mit dem Harne nach außen abgeführt.
Die harnbildenden „Schleifenkanäle“ öder-' „Urnieren“
dienen demnach bei den weiblichen Ringelwürmern zugleich als
„Eileiter“, bei den männlichen als „Samenleiter“.
Sehr ähnlich diesen Segmentalnieren der Annehden, aber doch
sehr wesentlich verschieden verhält sich das Nie r ens ys tem
der Wi rbe l t ie re . Die eigentümliche Entwickelung desselben
und seine Beziehungen zu den Geschlechtsorganen gehören zu den
schwierigsten Aufgaben, welche uns die Morphologie dieses Stammes
darbietet. Obwohl deren Lösung schon früher durch eine Reihe
ausgezeichneter Beobachter (Johannes Müller, Rathke, Wilhelm
Müller, Fürbringer u. a.) angebahnt war, ist sie doch erst durch
die vergleichend-ontogenetischen Entdeckungen der letzten Jahrzehnte
sehr weit gefördert worden, namentlich durch die wichtigen
Untersuchungen von J. Rückert und J. Van Wijhe bei Selachiern,
von Theodor Boveri bei Amphioxus und von Richard Semon bei
Ichthyophis (vergl. S. 870). Durch diese planvoll durchgeführten
und im Lichte der Descendenztheorie kritisch-vergleichenden Forschungen
sind uns viele merkwürdige Tatsachen palingenetisch
verständlich geworden, welche man früher in der Ontogenie unseres
Urogenitalsystems als rätselhafte Wunder anstaunte; und zugleich
haben wir die cenogenetische Bedeutung mancher auffallender
sekundärer Abweichungen von dem ursprünglichen primären
Bildungsgänge verstehen gelernt.
Werfen wir von diesem phylogenetischen, durch die neueren
Untersuchungen befestigten Standpunkte einen übersichtlichen
Blick auf das Nierensystem der Vertebraten, so können wir allgemein
drei verschiedene Formen desselben unterscheiden: 1) Vo r nie
re n oder Kopfnieren S{Pronephros), 2) Urnie r en oder
Mittelnieren (Mesonephros), 3) Na chnie r en oder Dauernieren
(Metanephros). Diese drei Nie r ens y s t eme sind nicht fundamental
verschieden und völlig getrennt, wie frühere Beobachter
(z. B. Semper) -irrtümlich annahmen, sondern sie stellen drei
ve r s chiedene Generat ionen eines und desselben Exkretions-
Apparates dar; sie entsprechen drei verschiedenen phylogenetischen
Entwickelungsstufen und folgen in der Stammesgeschichte der
Wirbeltiere dergestalt aufeinander, daß jede jüngere und vollkommenere
Generation weiter hinten im Körper sich entwickelt
und die zeitlich und räumlich vorhergehende, ältere und niedere
Generation verdrängt. Die Vo rn i e r e oder „Kopfniere , zuerst
von Wilhelm Müller 1875 bei den Cyclostomen und Ichthyoden
genau beschrieben, bildet das einzige Exkretionsorgan der
Ac r an i e r {Amphioxus)-, sie besteht auch noch fort bei den Rundmäulern
und einigen Fischen, kommt aber nur spurweise oder
vorübergehend im Keime der sechs übrigen Vertebratenklassen zur
Anlage. Die Urni e r e tritt zuerst bei den Cy clostomen hinter
der Vomiere auf; sie hat sich von den Selachiern auf alle Gnatho-
stomen vererbt. Bei den Anamnien ist sie zeitlebens als Hara-
drüse tätig; bei den Amnioten hingegen verwandelt sich ihr
vorderer Teil („Germinalniere“) in Organe des Geschlechtsapparates,
während aus dem Ende ihres hinteren Teiles („Urinalniere“) die
dritte Generation hervorsproßt, die charakteristische „Dauer-
nie re“ oder Nachniere der drei höheren Vertebratenklassen. Der
ontogenetischen Reihenfolge, in welcher die drei Nierensysteme
beim Embryo des Menschen und der höheren Wirbeltiere nacheinander
auftreten, entspricht ihre phylogenetische Succession in
unserer Stammesgeschichte, und demgemäß auch im natürlichen
System der Wirbeltiere. .
Da die segmentale Anlage und Struktur der Nieren K g ursprünglich
je ein Paar Schläuche auf jedes Körpersegment — sich