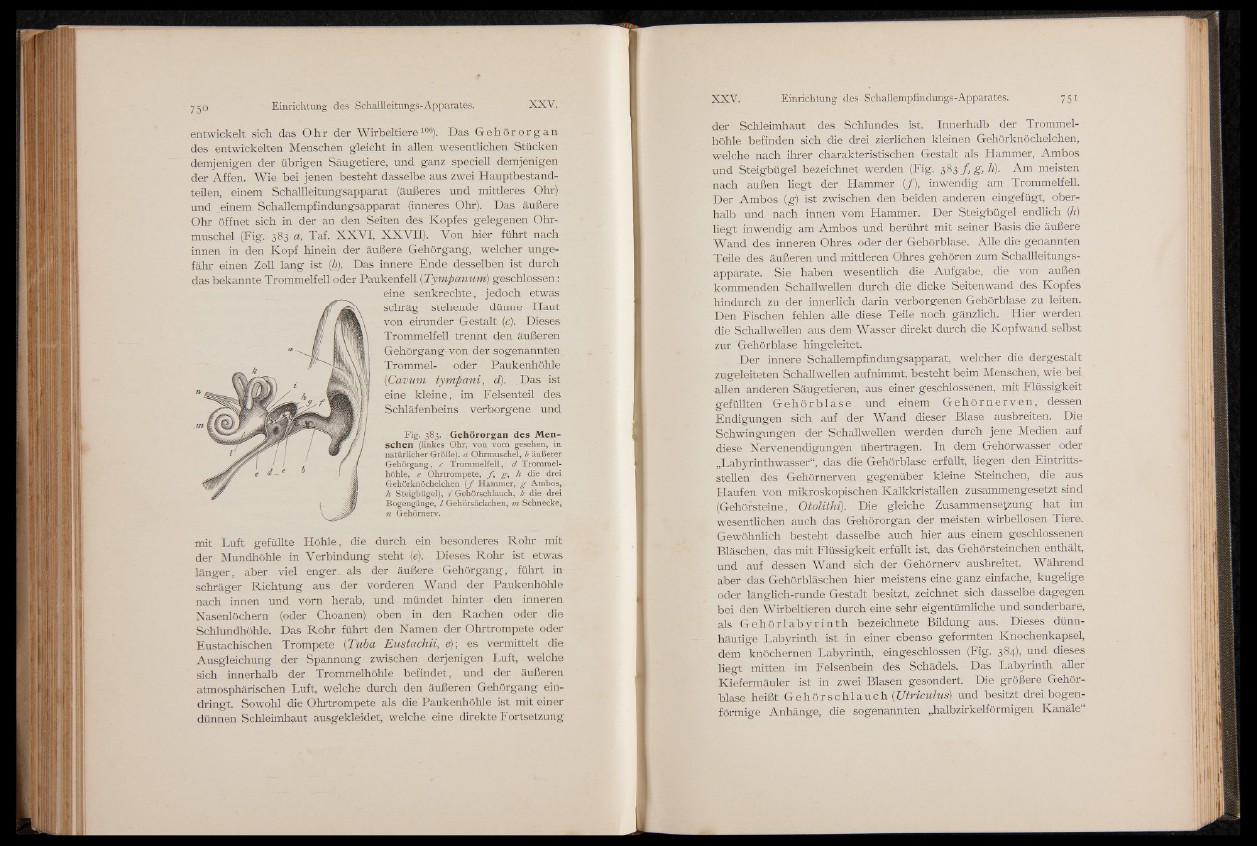
entwickelt sich das Ohr der Wirbeltiere106). Das Gehö ro rg an
des entwickelten Menschen gleicht in allen wesentlichen Stücken
demjenigen der übrigen Säugetiere, und ganz speciell demjenigen
der Affen. Wie bei jenen besteht dasselbe aus zwei Hauptbestandteilen,
einem Schallleitungsapparat (äußeres und mittleres Ohr)
und einem Schallempfindungsapparat (inneres Ohr). Das äußere
Ohr öffnet sich in der an den Seiten des Kopfes gelegenen Ohrmuschel
(Fig. 383 a, Taf. XXVI, XXVII). Von hier führt nach
innen in den Kopf hinein der äußere Gehörgang, welcher ungefähr
einen Zoll lang ist (b). Das innere Ende desselben ist durch
das bekannte Trommelfell oder Paukenfell (Tympanum) geschlossen :
eine senkrechte, jedoch etwas
schräg stehende dünne Haut
von eirunder Gestalt (c). Dieses
Trommelfell trennt den äußeren
Gehörgang- von der sogenannten
Trommel- oder Paukenhöhle
(Cavum tympani, d). Das ist
eine kleine,: im Felsenteil des
Schläfenbeins verborgene und
Fig. 383. Gehörorgan des Men-
sehen (linkes Ohr, von vom gesehen, in
natürlicher Größe), a Ohrmuschel, b äußerer
Gehörgang, c Trommelfell, d Trommelhöhle,
e Ohrtrompete, f y g y h die drei
Gehörknöchelchen { ƒ Hammer, g Ambos,
h Steigbügel), z Gehörschlauch, k die drei
Bogengänge, l Gehörsäckchen, m Schnecke,
n Gehörnerv.
mit Luft gefüllte Höhle, die durch ein besonderes Rohr mit
der Mundhöhle in Verbindung steht (e). Dieses Rohr ist etwas
länger) aber viel enger als der äußere Gehörgang, führt in
schräger Richtung aus der vorderen Wand der Paukenhöhle
nach innen und vom herab, und mündet hinter den inneren
Nasenlöchern (oder Choanen) oben in den Rachen oder die
Schlundhöhle. Das Rohr führt den Namen der Ohrtrompete oder
Eustachischen Trompete (Tuba Eustachii, e); es vermittelt die
Ausgleichung der Spannung zwischen derjenigen Luft, welche
sich innerhalb der Trommelhöhle befindet, und der äußeren
atmosphärischen Luft, welche durch den äußeren Gehörgang eindringt.
Sowohl die Ohrtrompete als die Paukenhöhle ist mit einer
dünnen Schleimhaut ausgekleidet, welche eine direkte Fortsetzung
X X V . E in rich tu n g des Schallempfindungs-Apparates. 751
der Schleimhaut des Schlundes ist. Innerhalb der Trommelhöhle
befinden sich die drei zierlichen kleinen Gehörknöchelchen,
welche nach ihrer charakteristischen Gestalt als Hammer, Ambos
und Steigbügel bezeichnet werden (Fig. 383 ƒ, g, h). Am meisten
nach außen liegt der Hammer (ƒ), inwendig am Trommelfell.
Der Ambos {g) ist zwischen den beiden anderen eingefügt, oberhalb
und nach innen vom Hammer: Der Steigbügel endlich (h)
liegt inwendig am Ambos und berührt mit seiner Basis die äußere
Wand des inneren Ohres oder der Gehörblase. Alle die genannten
Teile des äußeren und mittleren Ohres gehören zum Schallleitungsapparate.
Sie haben wesentlich die Aufgabe, die von außen
kommenden Schallwellen durch die dicke Seitenwand des Kopfes
hindurch zu der innerlich darin verborgenen Gehörblase zu leiten.
Den Fischen) fehlen alle diese Teile noch gänzlich. Hier werden
die Schallwellen aus dem Wasser direkt durch die Kopfwand selbst
zur 'Gehörblase hingeleitet.
Der innere Schallempfindungsapparat, welcher die dergestalt
zugeleiteten Schallwellen aufnimmt, besteht beim Menschen, wie bei
allen anderen Säugetieren, aus einer geschlossenen, mit Flüssigkeit
gefüllten Gehö rbla s e .und einem Gehörnerven, dessen
Endigungen sich auf der Wand dieser Blase ausbreiten. Die
Schwingungen der Schallwellen werden durch jene Medien auf
diese Nervenendigungen übertragen. In dem Gehörwasser oder
„Labyrinthwasser“, das die Gehörblase erfüllt, liegen den Eintrittsstellen
des Gehörnerven gegenüber kleine Sternchen, die aus
Haufen von mikroskopischen Kalkkristallen zusammengesetzt sind
(Gehörsteine, Otolithi). Die gleiche Zusammensetzung hat im
wesentlichen auch das Gehörorgan der meisten wirbeEosen Tiere.
Gewöhnhch besteht dasselbe auch hier aus einem geschlossenen
Bläschen, das mit Flüssigkeit erfüEt ist, das Gehörsteinchen enthält,
und auf dessen Wand sich der Gehörnerv ausbreitet. Während
aber das Gehörbläschen hier meistens eine ganz einfache, kugelige
oder länglich-runde Gestalt besitzt, zeichnet sich dasselbe dagegen
bei den Wirbeltieren durch eine sehr eigentümliche und sonderbare,
als Gehö r laby r inth bezeichnete Bildung aus. Dieses dünnhäutige
Labyrinth ist in einer ebenso geformten Knochenkapsel,
dem knöchernen Labyrinth, eingeschlossen (Fig. 384), und dieses
liegt mitten im Felsenbein des Schädels. Das Labyrinth aUer
Kiefermäuler ist in zwei Blasen gesondert. Die größere Gehörblase
heißt Gehö r s chlauch (Utriculus) und besitzt drei bogenförmige
Anhänge, die sogenannten „halbzirkelförmigen Kanäle“