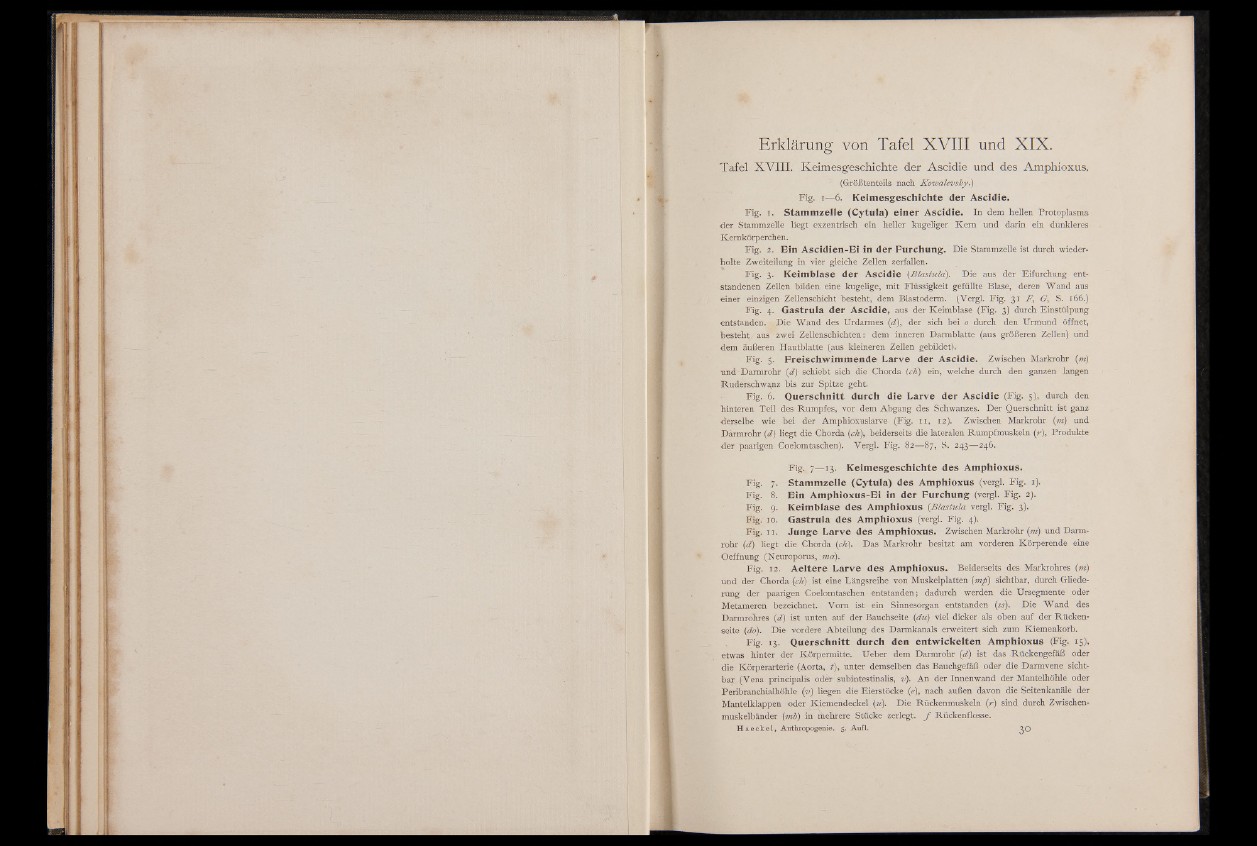
Erklärung von Tafel XVIII und XIX.
Tafel XVIII. Keimesgeschichte der Ascidie und des Amphioxus.
: (Größtenteils nach Kowalevsky.)
Fig. i—6. Keimesgeschichte der Ascidie.
Fig. i. Stammzelle (Cytula) einer Ascidie. In dem hellen Protoplasma
■ der Stammzelle liegt exzentrisch ein heller kugeliger Kern und darin ein dunkleres
Kernkörperchen.
Fig. 2. Ein Ascidien-Ei in der Furchung. Die Stammzelle ist durch wiederholte
Zweiteilung in vier gleiche Zellen zerfallen.
Fig. 3. Keimblase der Ascidie (B lastula). Die aus der Eifurchung entstandenen
Zellen bilden eine kugelige, mit Flüssigkeit gefüllte Blase, deren Wand aus
einer einzigen Zellenschicht besteht, dem Blastoderm. (Vergl. Fig. 31 B , G, S. 166.)
Fig. 4. Gastrula der Ascidie, aus der Keimblase (Fig. 3) durch Einstülpung
entstanden. Die Wand des Urdarmes (d), der sich bei o durch den Urmund öffnet,
besteht aus • zwei Zellenschichten: dem inneren Darmblatte (aus größeren Zellen) und
■ dem äußeren Hautblatte (aus kleineren Zellen gebildet).
Fig. 5. Freischwimmende Larve der Ascidie. Zwischen Markrohr (m)
und Darmrohr (d) schiebt sich die Chorda (ch) ein, welche durch den ganzen langen
Ruderschwanz bis zur Spitze geht.
Fig. 6. Querschnitt durch die Larve der Ascidie (Fig. 5), durch den
hinteren Teil des Rumpfes, vor dem Abgang des Schwanzes. Der Querschnitt ist ganz
derselbe wie bei der Amphioxuslarve (Fig. 11, 12). Zwischen Markrohr (m) und
Därmrohr (d) liegt die Chorda {ch), beiderseits die lateralen Rumpfmuskeln (r), Produkte
der paarigen Coelomtaschen). Vergl. Fig. 82— 87, S. 243— 246.
Fig. 7— 13. Keimesgeschichte des Amphioxus.
Fig. 7. Stammzelle (Cytula) des Amphioxus (vergl. Fig. 1).
Fig. 8. Ein Amphioxus-Ei in der Furchung (vergl. Fig. 2).
Fig. 9. Keimblase des Amphioxus {Blastula vergl. Fig. 3).
Fig. 10. Gastrula des Amphioxus (vergl. Fig. 4).
Fig. 11. Junge Larve des Amphioxus. Zwischen Markrohr (m) und Darmrohr
(d) liegt die Chorda {ch). Das Markrohr besitzt am vorderen Körperende eine
Oeffnung (Neuroporus, ma).
Fig. 12. Aeltere Larve des Amphioxus. Beiderseits des Markrohres (m)
und der Chorda {ch) ist eine Längsreihe von Muskelplatten {mp) sichtbar, durch Gliederung
der paarigen Coelomtaschen entstanden; dadurch werden die Ursegmente oder
Metameren bezeichnet. Vom ist ein Sinnesorgan entstanden {ss). Die Wand des
Darmrohres {d) ist unten auf der Bauchseite {du) viel dicker als oben auf der Rückenseite
(do). Die vordere Abteilung des Darmkanals erweitert sich zum Kiemenkorb.
Fig. 13. Querschnitt durch den entwickelten Amphioxus (Fig. 15),
etwas hinter der Körpermitte. Ueber dem Darmrohr {d) ist das Rückengefäß oder
die Körperarterie (Aorta, t), unter demselben das Bauchgefäß oder die Darmvene sichtbar
(Vena principalis oder subintestinalis, v). An der Innenwand der Mantelhöhle oder
Peribranchialhöhle {v) liegen die Eierstöcke (<?), nach außen davon die Seiten kanäle der
Mantelklappen oder Kiemendeckel {u). Die Rückenmuskeln {r) sind durch Zwischenmuskelbänder
{mb) in mehrere Stücke zerlegt, f Rückenflosse.
Haeckel, Anthropogenie. 5. Aufl. 30