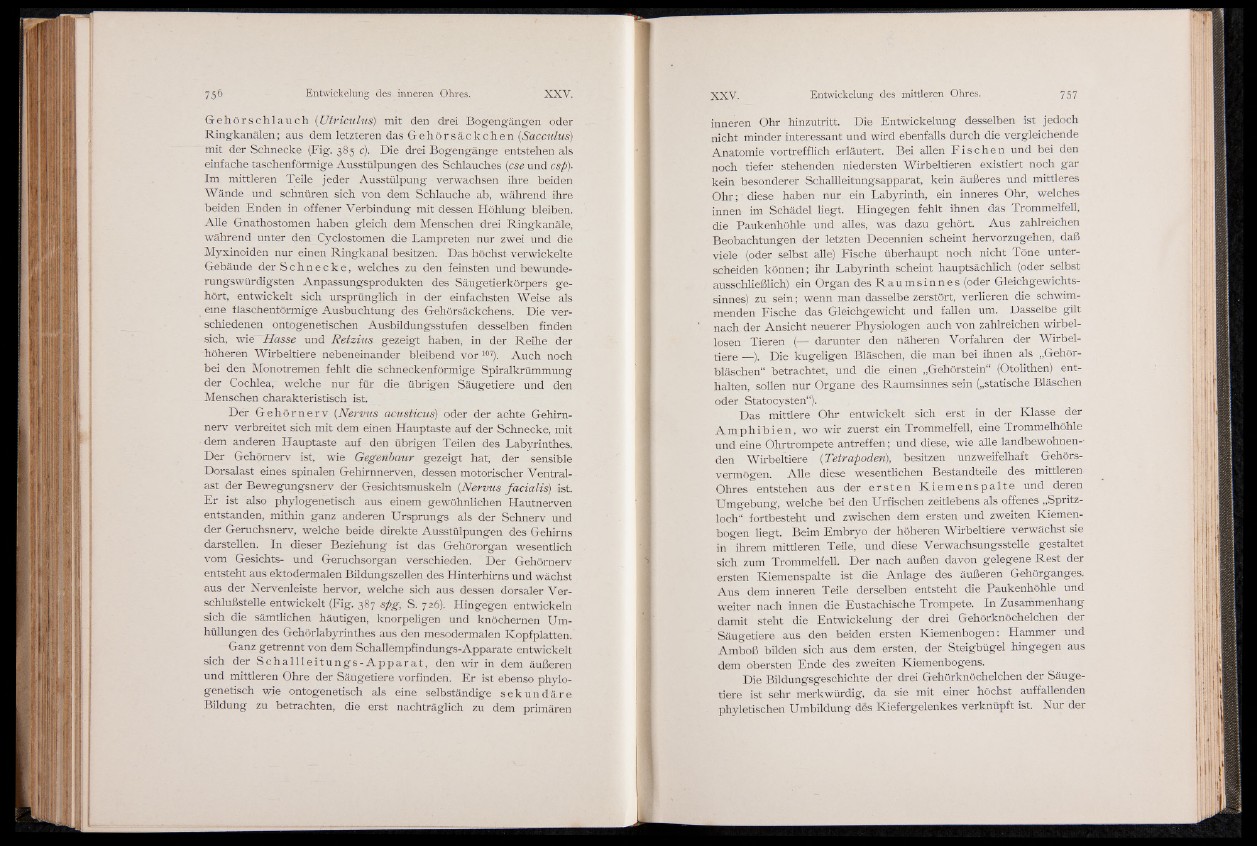
Gehö r s chlauch (Utriculus) mit den drei Bogengängen oder
Ringkanälen; aus dem letzteren das Gehö r sä ckchen (Sacculus)
mit der Schnecke (Fig. 385 c). Die drei Bogengänge entstehen als
einfache taschenförmige Ausstülpungen des Schlauches (cse und csp).
Im mittleren Teile jeder Ausstülpung verwachsen ihre beiden
Wände und schnüren sich von dem Schlauche ab, während ihre
beiden Enden in offener Verbindung mit dessen Höhlung bleiben.
Alle Gnathostomen haben gleich dem Menschen drei Ringkanäle,
während unter den Cyclostomen die Lampreten nur zwei und die
Myxinoiden nur einen Ringkanal besitzen. Das höchst verwickelte
Gebäude der S ch ne c k e , welches zu den feinsten und bewunderungswürdigsten
Anpassungsprodukten des Säugetierkörpers gehört,
entwickelt sich ursprünglich in der einfachsten Weise als
eine flaschenförmige Ausbuchtung des Gehörsäckchens. Die verschiedenen
ontogenetischen Ausbildungsstufen desselben finden
sich, wie Hasse und Retzius gezeigt haben, in der Reihe der
höheren Wirbeltiere nebeneinander bleibend vor107). Auch noch
bei den Monotremen fehlt die schneckenförmige Spiralkrümmung
der Cochlea, welche nur für die übrigen Säugetiere und den
Menschen charakteristisch ist.
Der Gehörne rv (Nervus acusticus) oder der achte Gehirnnerv
verbreitet sich mit dem einen Hauptaste auf der Schnecke, mit.
dem anderen Hauptaste auf den übrigen Teilen des Labyrinthes.
Der Gehörnerv ist, wie Gegenbaur gezeigt hat, der sensible
Dorsalast eines spinalen Gehirnnerven, dessen motorischer Ventralast
der Bewegungsnerv der Gesichtsmuskeln (Nervus facialis) ist.
Er ist also phylogenetisch aus einem gewöhnlichen Hautnerven
entstanden, mithin ganz anderen Ursprungs als der Sehnerv und
der Geruchsnerv, welche beide direkte Ausstülpungen des Gehirns
darstellen. In dieser Beziehung ist das Gehörorgan wesentlich
vom Gesichts- und Geruchsorgan verschieden. Der Gehörnerv
entsteht aus ektodermalen Bildungszellen des Hinterhirns und wächst
aus der Nervenleiste hervor, welche sich aus dessen dorsaler Verschlußstelle
entwickelt (Fig. 387 spg, S. 726). Hingegen entwickeln
sich die sämtlichen häutigen, knorpeligen und knöchernen Umhüllungen
des Gehörlabyrinthes aus den mesodermalen Kopfplatten.
Ganz getrennt von dem Schallémpfindungs-Apparate entwickelt
sich der S c h a l l l e i tu n g s -Ap p a r a t , den wir in dem äußeren
und mittleren Ohre der Säugetiere vorfinden. Er ist ebenso phylogenetisch
wie ontogenetisch als eine selbständige sekundär e
Bildung zu betrachten, die erst nachträglich zu dem primären
inneren Ohr hinzutritt. Die Entwickelung desselben ist jedoch
nicht minder interessant und wird ebenfalls durch die vergleichende
Anatomie vortrefflich erläutert. Bei allen Fi s chen und bei den
noch tiefer stehenden niedersten Wirbeltieren existiert noch gar
kein besonderer Schallleitungsapparat, kein äußeres und mittleres
Ohr ; ' diese haben nur ein Labyrinth, ein inneres Ohr, welches
innen im Schädel Hegt. Hingegen fehlt ihnen das TrommelfeU,
die Paukenhöhle und alles, was dazu gehört. Aus zahlreichen
Beobachtungen der letzten Decennien scheint hervorzugehen, daß
viele (oder selbst alle) Fische überhaupt noch nicht Töne unterscheiden
können; ihr Labyrinth scheint hauptsächlich (oder selbst
ausschHeßhch) ein Organ des Raums inne s (oder Gleichgewichtssinnes)
zu sein ; wenn man dasselbe zerstört, verlieren die schwimmenden
Fische das Gleichgewicht und fallen um. Dasselbe gilt
nach der Ansicht neuerer Physiologen auch von zahlreichen wirbellosen
Tieren (-«£ darunter den näheren Vorfahren der Wirbeltiere
—). Die kugeHgen Bläschen, die man bei ihnen als „Gehörbläschen“
betrachtet, und die einen „Gehörstein“ (OtoHthen) enthalten,
sollen nur Organe des Raumsinnes sein („statische Bläschen
oder Statocysten“).
Das mittlere Ohr entwickelt sich erst in der Klasse der
Amphibien, wo wir zuerst ein TrommelfeH, eine Trommelhöhle
und eine Ohrtrompete antreffen ; und diese, wie alle landbewohnen-'
den Wirbeltiere (Tetrapoden), besitzen unzweifelhaft Gehörsvermögen.
Alle diese wesentlichen Bestandteile des mittleren
Ohres entstehen aus der erste n Kiemensp a l t e und deren
Umgebung, welche bei den Urfischen zeitlebens als offenes „Spritzloch“
fortbesteht und zwischen dem ersten und zweiten Kiemenbogen
Hegt. Beim Embryo der höheren Wirbeltiere verwächst sie
in ihrem mittleren Teile, und diese Verwachsungsstelle gestaltet
sich zum TrommelfeU. Der nach außen davon gelegene Rest der
ersten Kiemenspalte ist die Anlage des äußeren Gehörganges.
Aus dem inneren Teile derselben entsteht die Paukenhöhle und
weiter nach innen die Eustachische Trompete. In Zusammenhang
damit steht die Entwickelung der drei Gehörknöchelchen der
Säugetiere aus den beiden ersten Kiemenbogen: Hammer und
Amboß bilden sich aus dem ersten, der Steigbügel hingegen aus
dem obersten Ende des zweiten Kiemenbogens.
Die Bildungsgeschichte der drei Gehörknöchelchen der Säugetiere
ist sehr merkwürdig, da sie mit einer höchst auffaUenden
phyletischen Umbildung dSs Kiefergelenkes verknüpft ist. Nur der