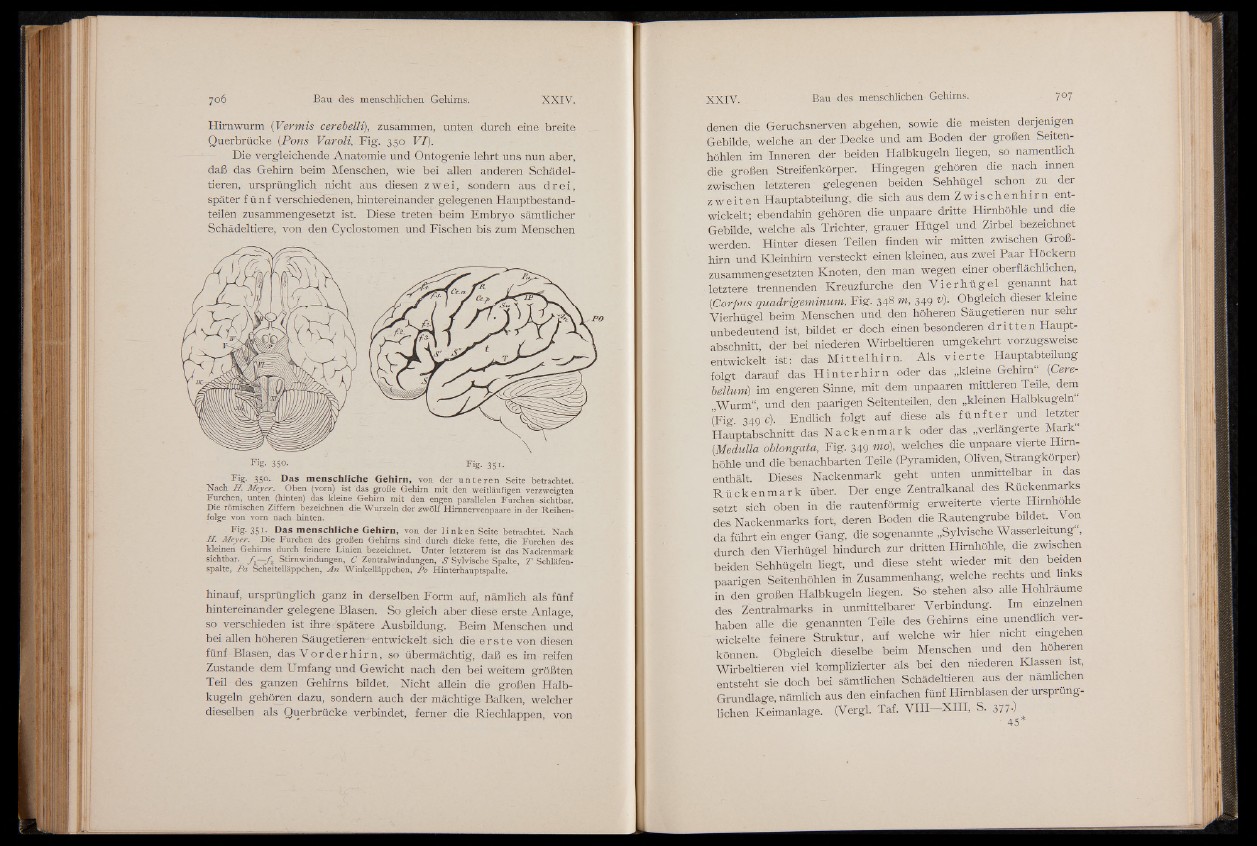
Hirnwurm (Vermis cerebelli), zusammen, unten durch eine breite
Querbrücke (Pons Varoli, Fig. 350 VI).
Die vergleichende Anatomie und Ontogenie lehrt uns nun aber,
daß das Gehirn beim Menschen, wie bei allen anderen Schädeltieren,
ursprünglich nicht aus diesen zwei , sondern aus drei,
später fünf verschiedenen, hintereinander gelegenen Hauptbestandteilen
zusammengesetzt ist. Diese treten beim Embryo sämtlicher
Schädeltiere, von den Cyclostomen und Fischen bis zum Menschen
Fig* 35° - Das menschliche Gehirn, von der u n te r e n Seite betrachtet.
Nach H . Meyer. Oben (vom) ist das große Gehirn mit den weitläufigen verzweigten
Furchen, unten (hinten) das kleine Gehirn mit den engen parallelen Furchen- sichtbar.
Die römischen Ziffern bezeichnen die Wurzeln der zwölf Himnervenpaare in der Reihenfolge
von vom nach hinten.
Fig-3 5T* Das menschliche Gehirn, von der l in k e n Seite betrachtet. Nach
H . Meyer. Die Furchen des großen Gehirns sind durch dicke fette, die Furchen des
kleinen Gehirns durch feinere Linien bezeichnet. Unter letzterem ist das Nackenmark
sichtbar. f x— Stimwindungen, C Zentralwindungen, S Sylvische Spalte, T Schläfen-
spalte, Pa Scheitelläppchen, A n Winkelläppchen, Po Hinterhauptspalte.
hinauf, ursprünglich ganz in derselben Form auf, nämlich als fünf
hintereinander gelegene Blasen. So gleich aber diese erste Anlage,
so verschieden ist ihre- spätere Ausbildung. Beim Menschen und
bei allen höheren Säugetieren- entwickelt .sich die erste von diesen
fünf Blasen, das Vorde rhi rn, so übermächtig, daß es im reifen
Zustande dem Umfang und Gewicht nach den bei weitem größten
Teil des ganzen Gehirns bildet. Nicht allein die großen Halbkugeln
gehören dazu, sondern auch der mächtige Balken, welcher
dieselben als Querbrücke verbindet, ferner die Riechlappen, von
denen die Geruchsnerven abgehen, sowie die meisten derjenigen
Gebilde, welche an der Decke und am Boden der großen Seitenhöhlen
im Inneren der beiden Halbkugeln Hegen, so namentlich
die großen Streifenkörper. Hingegen gehören die nach innen
zwischen letzteren gelegenen beiden Sehhügel schon ^ zu der
zwei ten Hauptabteilung, die sich aus dem Zwi s chenhi rn entwickelt;
ebendahin gehören die unpaare dritte Hirnhöhle und die
Gebilde, welche als Trichter, grauer Hügel und Zirbel bezeichnet
werden.’ Hinter diesen Teilen finden wir mitten zwischen Großhirn
und Kleinhirn versteckt einen kleinen, aus zwei Paar Höckern
zusammengesetzten Knoten, den man wegen einer oberflächHchen,
letztere trennenden Eireuzfurche den V i e rh ü g e l genannt hat
(1Corpus quadrigeminum, Fig. 348 m, 349 v). Obgleich dieser kleine
Vierhügel beim Menschen und den höheren Säugetieren nur sehr
unbedeutend ist, bildet er doch einen besonderen dr i t ten Hauptabschnitt,
der bei niederen Wirbeltieren umgekehrt vorzugsweise
entwickelt ist: das Mit telhirn . Als vie r te Hauptabteilung
folgt darauf das Hinte rhi rn oder das „kleine Gehirn“ (Cere-
beilum) im engeren Sinne, mit dem unpaaren mittleren Teile, dem
„Wurm“, und den paarigen Seitenteilen, den „kleinen Halbkugeln
(Fig. 349 c). EndHch folgt auf diese als fünf te r und letzter
Hauptabschnitt das Na ck enma rk oder das „verlängerte Mark
(Medulla oblongata, Fig. 349 mo\ welches die unpaare vierte Hirnhöhle
und die benachbarten TeHe (Pyramiden, OHven, Strangkörper)
enthält. Dieses Nackenmark geht unten unmittelbar in das
Rü c k enma rk über. Der enge Zentralkanal des Rückenmarks
setzt sich oben in die rautenförmig erweiterte vierte Hirnhöhle
des Nackenmarks fort, deren Boden die Rautengrube bildet. Von
da führt ein enger Gang, die sogenannte „Sylvische Wasserleitung ,
durch den Vierhügel hindurch zur dritten Himhöhle, die zwischen
beiden Sehhügeln Hegt, und diese steht wieder mit den beiden
paarigen Seitenhöhlen in Zusammenhang, welche rechts und hnks
in den großen Halbkugeln Hegen. So stehen also aHe Hohlräume
des Zentralmarks in unmittelbarer Verbindung. Im einzelnen
haben aHe die genannten Teile des Gehirns eine unendHch verwickelte
feinere Struktur, auf welche wir hier nicht emgehen
können. Obgleich dieselbe beim Menschen und den höheren
Wirbeltieren viel kompHzierter als bei den niederen Klassen ist,
entsteht sie doch bei sämtHchen Schädeltieren aus der nämlichen
Grundlage, nämHch aus den einfachen fünf Hirnblasen der ursprüng-
Hchen Keimanlage. (Vergl. Taf. VIH—XIII, S. 377*)
- 45*