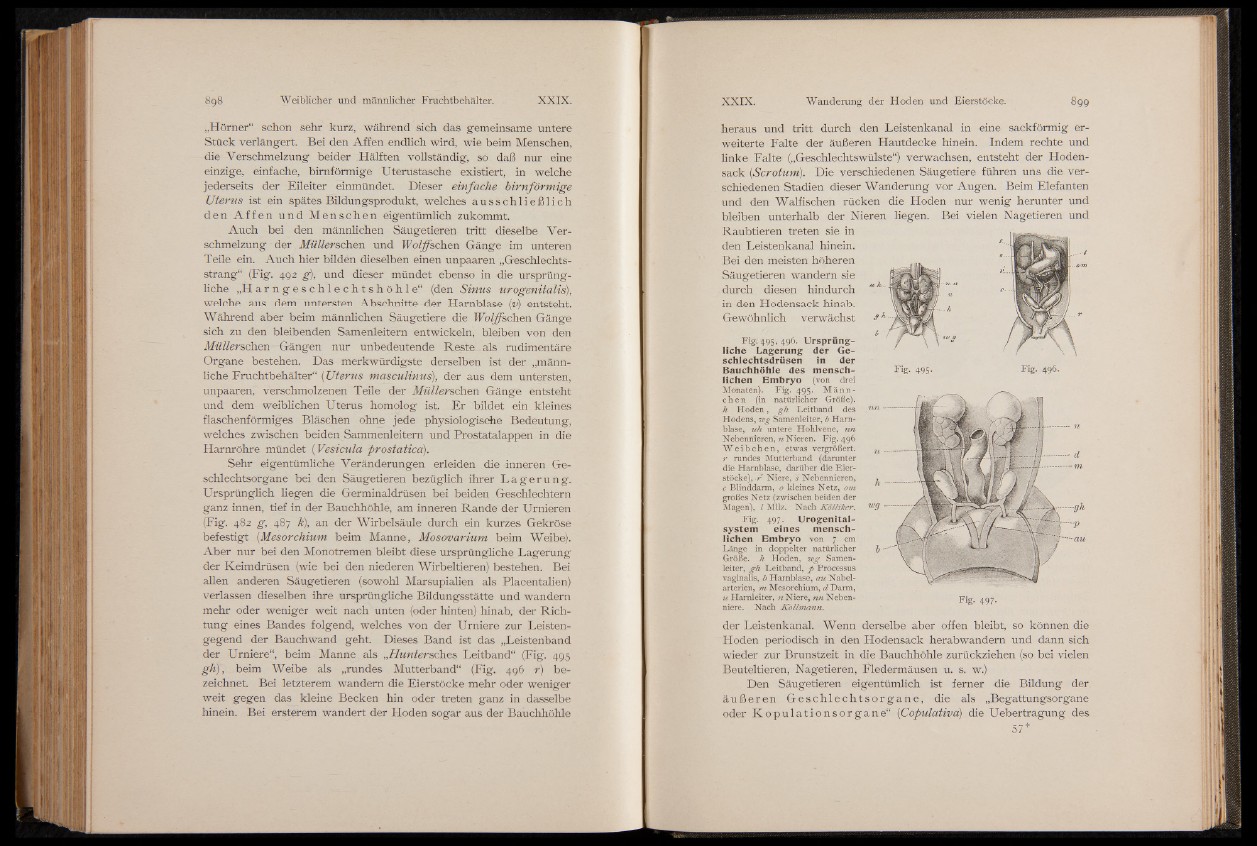
„Hörner“ schon sehr kurz, während sich das gemeinsame untere
Stück verlängert. Bei den Affen endlich wird, wie beim Menschen,
die Verschmelzung beider Hälften vollständig, so daß nur eine
einzige, einfache, bimförmige Uterüstasche existiert, in welche
jederseits der Eileiter einmündet. Dieser einfache hirnförmige
Uterus ist ein spätes Bildungsprodukt, welches aus s chl ießl i ch
den Af f e n und Menschen eigentümlich zukommt.
Auch bei den männlichen Säugetieren tritt dieselbe Verschmelzung
der Müller sehen und Wölfischen Gänge im unteren
Teile ein. Auch hier bilden dieselben einen unpaaren „Geschlechtsstrang“
(Fig. 492 g), und dieser mündet ebenso in die ursprüngliche
„H a r n g e s c h l e c h t s h ö h l e “ (den Sinus urogenitalis),
welche aus dem untersten Abschnitte der Harnblase (v) entsteht.
Während aber beim männlichen Säugetiere die Wolffschen Gänge
sich zu den bleibenden Samenleitern entwickeln, bleiben von den
Müllerschen Gängen nur unbedeutende Reste als rudimentäre
Organe bestehen. Das merkwürdigste derselben ist der „männliche
Fruchtbehälter“ (Uterus masculinus), der aus dem untersten,
unpaaren, verschmolzenen Teile der Müllerschen Gänge entsteht
und dem weiblichen Uterus homolog ist. Er bildet ein kleines
flaschenförmiges Bläschen ohne jede physiologische Bedeutung,
welches zwischen beiden Sammenleitem und Prostatalappen in die
Harnröhre mündet (Vesicula prostatica).
Sehr eigentümliche Veränderungen erleiden die -inneren Geschlechtsorgane
bei den Säugetieren bezüglich ihrer L a g e rung .
Ursprünglich liegen die Germinaldrüsen bei beiden Geschlechtern
ganz innen, tief in der Bauchhöhle, am inneren Rande der Urnieren
(Fig. 482 g, 487 k), an der Wirbelsäule durch ein kurzes Gekröse
befestigt (Mesorchium beim Manne, Mosovarium beim Weibe).
Aber nur bei den Monotremen bleibt diese ursprüngliche Lagerung
der Keimdrüsen (wie bei den niederen Wirbeltieren) bestehen. Bei
allen anderen Säugetieren (sowohl Marsupialien als Placentalien)
verlassen dieselben ihre ursprüngliche Bildungsstätte und wandern
mehr oder weniger weit nach unten (oder hinten) hinab, der Richtung
eines Bandes folgend, welches von der Urniere zur Leistengegend
der Bauchwand geht. Dieses Band ist das „Leistenband
der Urniere“, beim Manne. als „Huntersches Leitband“ (Fig. 495
gh), beim Weibe als „rundes Mutterband“ (Fig. 496 r) bezeichnet.
Bei letzterem wandern die Eierstöcke mehr oder weniger
weit gegen das kleine Becken hin oder treten ganz in dasselbe
hinein. Bei ersterem wandert der Hoden sogar aus der Bauchhöhle
heraus und tritt durch den Leistenkanal in eine sackförmig erweiterte
Falte der äußeren Hautdecke hinein. Indem rechte und
linke Falte („Geschlechtswülste“) verwachsen, entsteht der Hodensack
(Scrotum). Die verschiedenen Säugetiere führen uns die verschiedenen
Stadien dieser Wanderung vor Augen. Beim Elefanten
und den Walfischen rücken die Hoden nur wenig herunter und
bleiben unterhalb der Nieren liegen. Bei vielen Nagetieren und
Raubtieren treten sie in
den Leistenkanal hinein.
Bei den meisten höheren
Säugetieren wandern sie
durch diesen hindurch
in den Hodensack hinab.
Gewöhnlich verwächst
F ig '495, 496. Ursprüngliche
Lagerung der Geschlechtsdrüsen
in der
Bauchhöhle des menschlichen
Embryo (von drei
Monaten). Fig. 495. Mä n n chen
(in natürlicher Größe).
h Hoden, g h Leitband des
Hodens, wg Samenleiter, b Harnblase,
uh untere Hohlvene, nn
Nebennieren, n Nieren. Fig. 496
We i b c h e n , etwas vergrößert.
r rundes Mutterband (darunter
die Harnblase, darüber die Eierstöcke),
-r Niere, r Nebennieren,
c Blinddarm, 0 kleines Netz, om
großes Netz (zwischen beiden der
Magen), l Milz. Nach K ölliker.
Fig. 497. Urogenitalsystem
eines menschlichen
Embryo von 7 cm
Länge in doppelter natürlicher
Größe, h Hoden, wg Samenleiter,
g h Leitband, p Processus
vaginalis, b Harnblase, au Nabelarterien,
m Mesorchium, d Darm,
u Harnleiter, 7z Niere, nn Nebenniere.
Nach Kollm ann.
Fig- 495- Fig. 496.
Fig. 497.
der Leistenkanal. Wenn derselbe aber offen bleibt, so können die
Hoden periodisch in den Hodensack herab wandern und dann sich
wieder zur Brunstzeit in die Bauchhöhle zurückziehen (so bei vielen
Beuteltieren, Nagetieren, Fledermäusen u. s. w.)
Den Säugetieren eigentümlich ist ferner die Bildung der
äußeren Ge s chle cht s o rg ane , die als „Begattungsorgane
oder Ko p u l a t io ns organe“ (Copulativa) die Uebertragung des