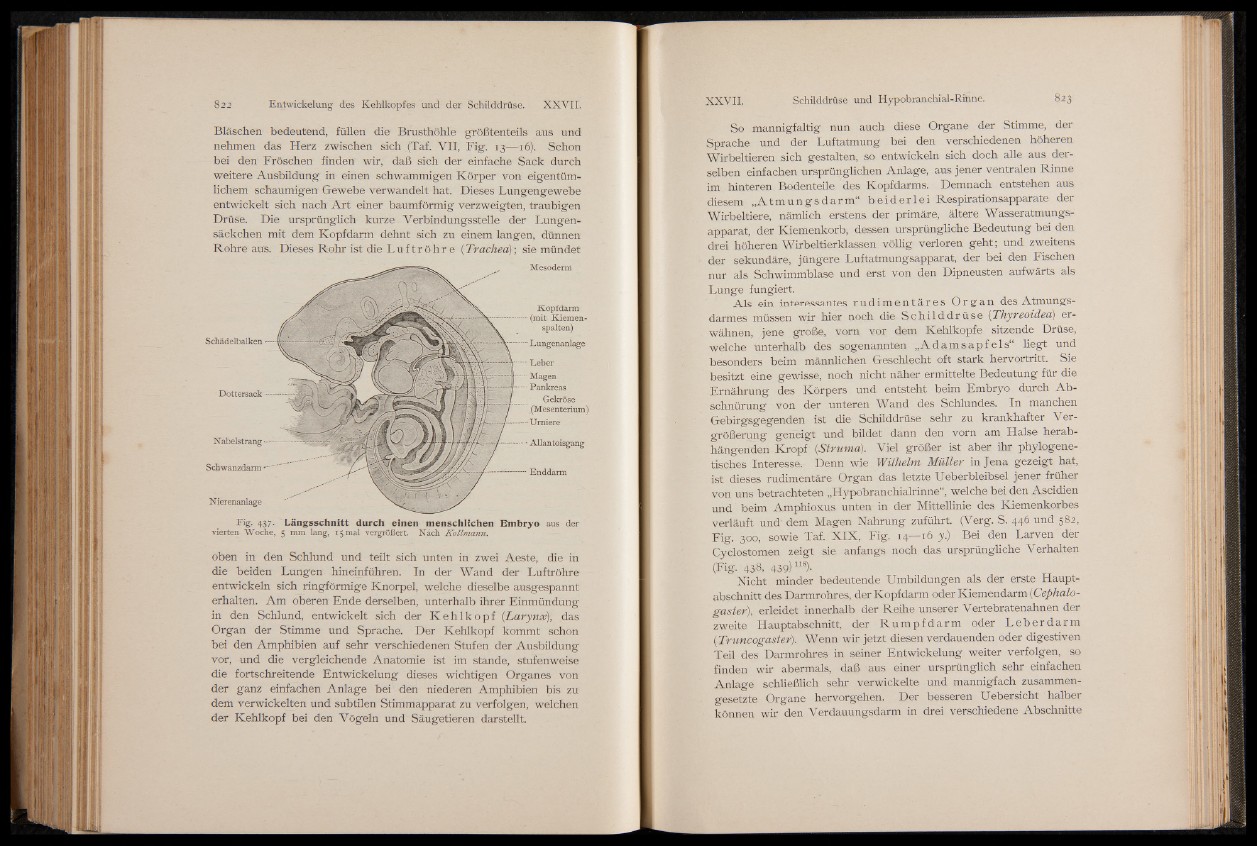
Bläschen bedeutend, füllen die Brusthöhle größtenteils aus und
nehmen das Herz zwischen sich (Taf. VII, Fig. 13— 16). Schon
bei den Fröschen finden wir, daß sich der einfache Sack durch
weitere Ausbildung in einen schwammigen Körper von eigentümlichem
schaumigen Gewebe verwandelt hat. Dieses Lungengewebe
entwickelt sich nach Art einer baumförmig verzweigten, traubigen
Drüse. Die ursprünglich kurze Verbindungsstelle der Lungensäckchen
mit dem Kopfdarm dehnt sich zu einem langen, dünnen
Rohre aus. Dieses Rohr ist die Lu f t rö hr e (Trachea); sie mündet
Mesoderm
Kopfdarm
(mit Kiemen-
spalten)
Limgenanlage
Leber
Magen
Pankreas
Gekröse
(Mesenterium)
Umiere
Allantoisgang
Enddarm
Schädelbalken
Dottersack —
Nabelstrang ■
Schwanzdarm
Nierenanlage
Fig. 437. Längsschnitt durch einen menschlichen Embryo aus der
vierten Woche, 5 mm lang, 15 mal vergrößert. Nach Kollm ann.
oben in den Schlund und teilt sich unten in zwei Aeste, die in
die beiden Lungen hineinführen. In der Wand der Luftröhre
entwickeln sich ringförmige Knorpel, welche dieselbe ausgespannt
erhalten. Am oberen Ende derselben, unterhalb ihrer Einmündung
in den Schlund, entwickelt sich der K e h lk o p f (Larynoc)•, das
Organ der Stimme und Sprache. Der Kehlkopf kommt schon
bei den Amphibien auf sehr verschiedenen Stufen der Ausbildung
vor, -und die vergleichende Anatomie ist im stände, stufenweise
die fortschreitende Entwickelung dieses wichtigen Organes von
der ganz einfachen Anlage bei den niederen Amphibien bis zu
dem verwickelten und subtilen Stimmapparat zu verfolgen, welchen
der Kehlkopf bei den Vögeln und Säugetieren darstellt.
So mannigfaltig nun auch diese Organe der Stimme, der
Sprache und der Luftatmung bei den verschiedenen höheren
Wirbeltieren sich gestalten, so entwickeln sich doch alle aus derselben
einfachen ursprünglichen Anlage, aus jener ventralen Rinne
im hinteren Bodenteile des Kopfdarms. Demnach entstehen aus
diesem „Atmungsda rm“ beider le i Respirationsapparate der
Wirbeltiere, nämlich erstens der primäre, ältere Wasseratmungs-
apparat, der Kiemenkorb, dessen ursprüngliche Bedeutung bei den
drei höheren Wirbeltierklassen völlig verloren geht; und zweitens
der sekundäre, jüngere Luftatmungsapparat, der bei den Fischen
nur als Schwimmblase und erst von den Dipneusten aufwärts als
Lunge fungiert.
Als ein interessantes rudimentäres Or gan des Atmungsdarmes
müssen wir hier noch die Schi lddrüse (Thyreoidea) erwähnen,
jene große, vorn vor dem Kehlkopfe sitzende Drüse,
welche iinterhalb des sogenannten „Adams apfe l s “ liegt und
besonders beim männlichen Geschlecht oft stark hervortritt. Sie
besitzt eine gewisse, noch nicht näher ermittelte Bedeutung für die
Ernährung des Körpers und entsteht beim Embryo durch Abschnürung
von der unteren Wand des Schlundes. In manchen
Gebirgsgegenden ist die Schilddrüse sehr zu krankhafter Vergrößerung
geneigt und bildet dann den vorn am Halse herabhängenden
Kropf {Struma). Viel größer ist aber ihr phylogenetisches
Interesse. Denn wie Wilhelm Müller in Jena gezeigt hat,
ist dieses rudimentäre Organ das letzte Ueberbleibsel jener früher
von uns betrachteten „Hypobranchialrinne“, welche bei den Ascidien
und beim Amphioxus unten in der Mittellinie des Kiemenkorbes
verläuft und' dem Magen Nahrung zuführt. (Verg. S. 446 und 582,
Fig. 300, sowie Taf. XIX, Fig. 14— 16 3».) Bei den Larven der
Cyclostomen zeigt sie anfangs noch das ursprüngliche Verhalten
(Fig. 438, 439)118)-
Nicht minder bedeutende Umbildungen als der erste Hauptabschnitt
des Darmrohres, der Kopf darm oder Kiemendarm (Cephalo-
gaster), erleidet innerhalb der Reihe unserer Vertebratenahnen der
zweite Hauptabschnitt, der Rumpfdarm oder Leberdarm
{Truncogaster). Wenn wir jetzt diesen verdauenden oder digestiven
Teil des Darmrohres in seiner Entwickelung weiter verfolgen, so
finden -wir abermals, daß aus einer ursprünglich sehr einfachen
Anlage schließlich sehr verwickelte und mannigfach zusammengesetzte
Organe hervorgehen. Der besseren Uebersicht halber
können wir den Verdauungsdarm in drei verschiedene Abschnitte