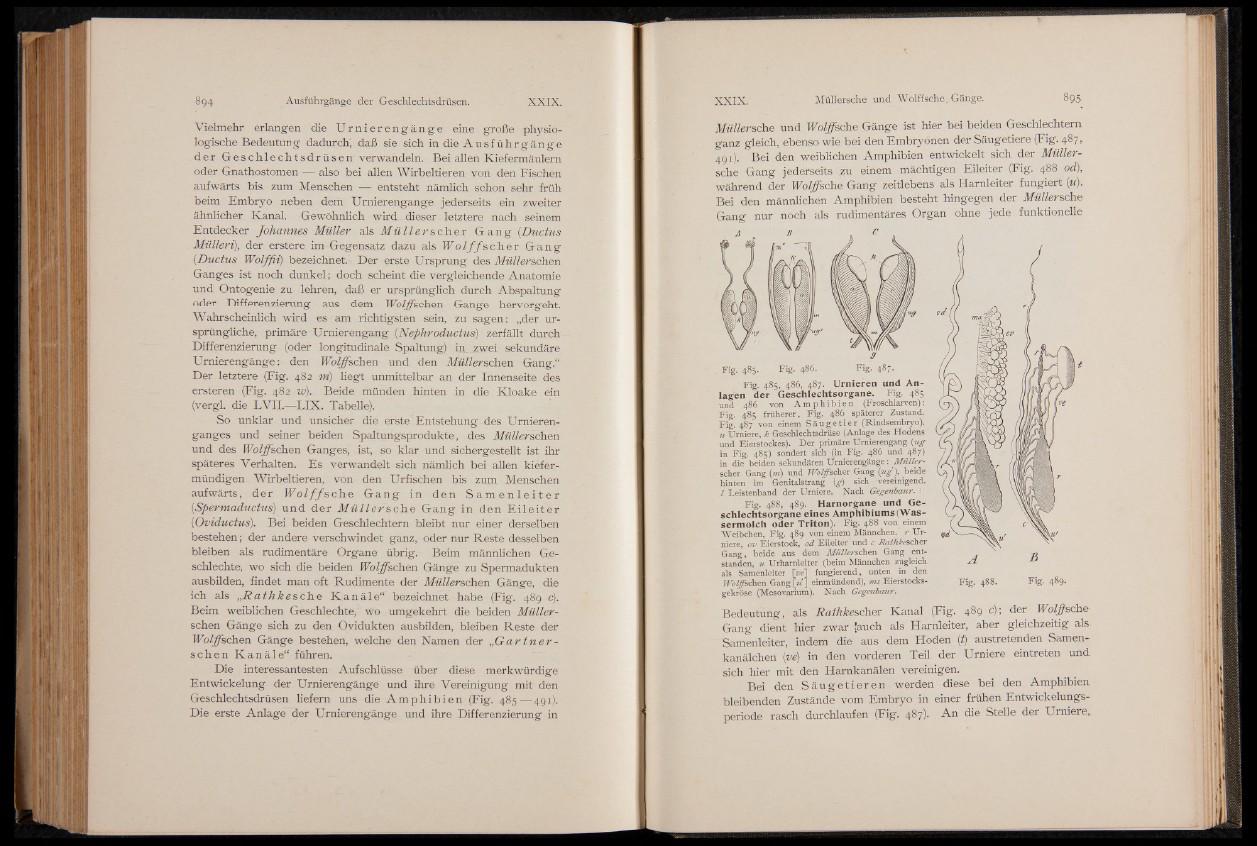
Vielmehr erlangen die Urn i e r e n g ä n g e eine große physiologische
Bedeutung dadurch; daß sie sich in die Au s f ühr g äng e
der Ge s chl e cht sdrüs en verwandeln. Bei allen Kiefermäulern
oder Gnathostomen — also bei allen Wirbeltieren von den Fischen
aufwärts bis zum Menschen — entsteht nämlich schon sehr früh
beim Embryo neben dem Urnierengänge jederseits ein zweiter
ähnlicher Kanal. Gewöhnlich wird dieser letztere nach seinem
Entdecker Johannes Müller als Mü l l e r scher Ga n g (Ductus
Mülleri), der erstere im Gegensatz dazu als Wo I f f s eher Gang
(Ductus Woljfii) bezeichnet. Der erste Ursprung des Müll ersehen
Ganges ist noch dunkel; doch scheint die vergleichende Anatomie
und Ontogenie zu lehren, daß er ursprünglich durch Abspaltung
oder Differenzierung aus dem Wolffsehen Gange hervorgeht.
Wahrscheinlich wird es am richtigsten sein, zu sagen: „der ursprüngliche,
primäre Urnierengang (Nephroductus) zerfällt durch
Differenzierung- (oder longitudinale Spaltung) in zwei sekundäre
Urnierengänge: den Wolffsehen und den Müllerschen Gang.“
Der letztere (Fig. 482 m) liegt unmittelbar an der Innenseite des
ersteren (Fig. 482 w). Beide münden hinten in die Kloake ein
(vergl. die LVII.—LIX. Tabelle).
So unklar und unsicher die erste Entstehung des Urnieren-
ganges und seiner beiden Spaltungsprodukte, des Müllerschen
und des Wolff sehen Ganges, ist, so klar und sichergestellt ist ihr
späteres Verhalten. Es verwandelt sich nämlich bei allen kiefermündigen
Wirbeltieren, von den Urfischen bis zum Menschen
aufwärts, der Wo l f f sehe Gang in den S am e n l e i t e r
(1Spermaductus) und der Mül l e r sehe Gang in den Ei lei t er
(Oviductus). Bei beiden Geschlechtern bleibt nur einer derselben
bestehen; der andere verschwindet ganz, oder nur Reste desselben
bleiben als rudimentäre Organe übrig. Beim männlichen Ge-
schlechte, wo sich die beiden Wolff sehen Gänge zu Spermadukten
ausbilden, findet man oft Rudimente der Müllerschen Gänge, die
ich als „Rathk e sehe Ka n ä l e “ bezeichnet habe (Fig. 489 c).
Beim weiblichen Geschlechte, wo umgekehrt die beiden Müllerschen
Gänge sich zu den Ovidukten ausbilden, bleiben Reste der
Wolff sehen Gänge bestehen, welche den Namen der „Gär tne r -
sehen K a n ä l e “ führen.
Die interessantesten Aufschlüsse über diese merkwürdige
Entwickelung der Urnierengänge und ihre Vereinigung mit den
Geschlechtsdrüsen liefern uns die Amphibien (Fig. 485 — 491).
Die erste Anlage der Urnierengänge und ihre Differenzierung in
Müliersche und Wolffsche Gänge ist hier bei beiden Geschlechtern
ganz gleich, ebenso wie bei den Embryonen der Säugetiere (Fig. 487,
491). Bei den weiblichen Amphibien entwickelt sich der Müliersche
Gang jederseits zu einem mächtigen Eileiter (Fig. 488 od),
während der Wolff-,sehe Gang zeitlebens als Harnleiter fungiert («).
Bei den männlichen Amphibien besteht hingegen der Müliersche
Gang nur noch als rudimentäres Organ ohne jede funktionelle
Fig. 485, 486, 487. Urnieren und Anlagen
der Geschlechtsorgane. Fig. 485
und 486 von Amp h i b i e n (Froschlarven):
Fig. 485 früherer, Fig. 486 späterer Zustand.
Fig. 487 von einem S äu g e t i e r (Rindsembryo).
u Umiere, k Geschlechtsdrüse (Anlage des Hodens
und Eierstockes). Der primäre Urnierengang {ug
ln Fig. 485) sondert sich (in Fig. 486 und 487)
in die beiden sekundären Urnierengänge: M üller-
scher Gang (w) und Jfh/^scher Gang lu g ), beide
hinten im Genitalstrang (g) sich vereinigend.
I Leistenband der Umiere. Nach Gegenbaur. 1
Fig. 488, 489. Harnorgane und Geschlechtsorgane
eines Amphibiums (Wassermolch
oder Triton). Fig. 488 von einem
Weibchen, Fig. 489 von einem Männchen, r Ur-
niere, ov Eierstock, od Eileiter und c Rathkescher
Gang, beide aus dem Müllersdaen Gang entstanden,
u Urharnleiter (beim Männchen zugleich
als Samenleiter \ye\ fungierend, unten in den
Woißsehen Gang [«'] einmündend), ms Eierstocksgekröse
(Mesovarium). Nach Gegenbaur.
Fig. 488. Fig. 489s
Bedeutung, als Rathke scher Kanal (Fig. 489 c); der Woffsche
Gang dient hier zwar fauch als Harnleiter, aber gleichzeitig als
Samenleiter, indem die aus dem Hoden (t) austretenden Samenkanälchen
(ve) in den vorderen Teil der Umiere eintreten und
sich hier mit den Harnkanälen vereinigen.
Bei den S äug e t ie r en werden diese bei den Amphibien
bleibenden Zustände vom Embryo in einer frühen Entwickelungsperiode
rasch durchlaufen (Fig. 487). An die Stelle der Urniere,