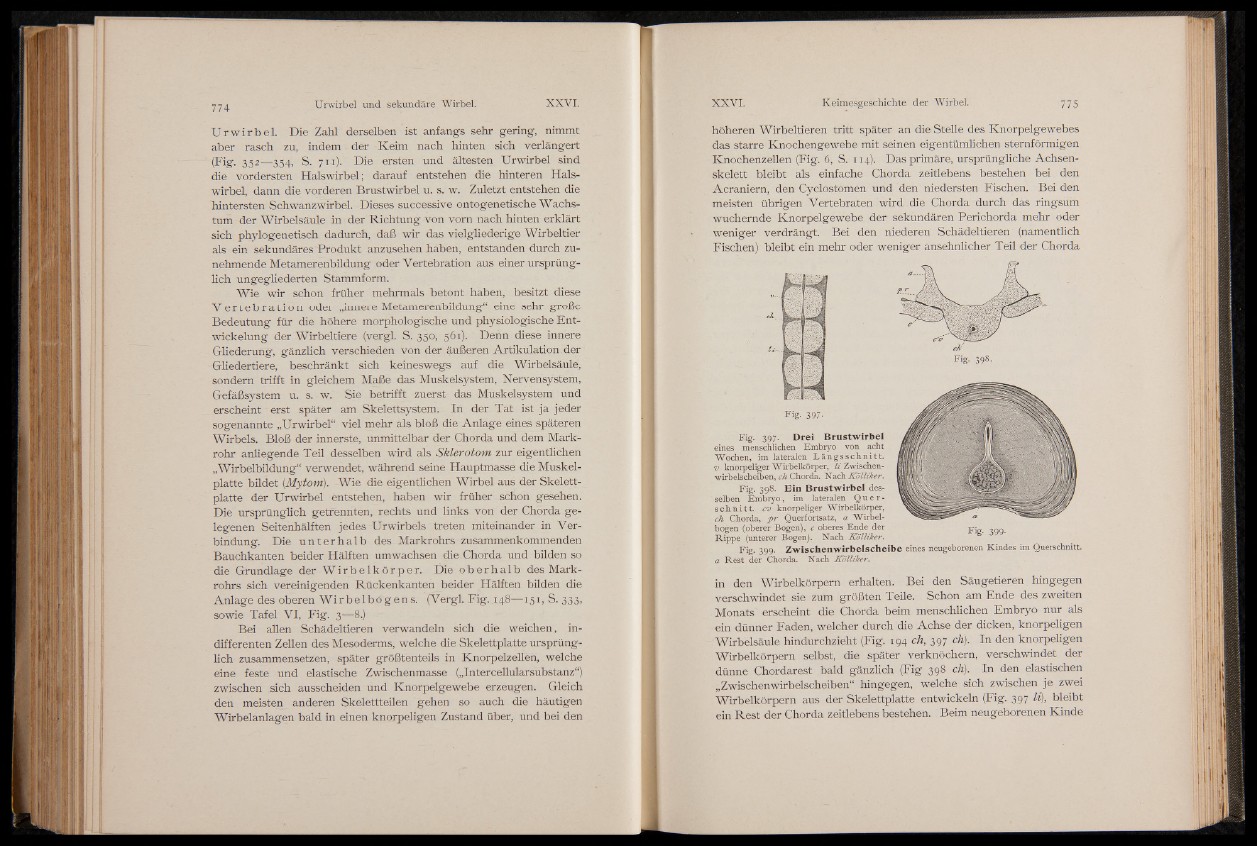
Urwi rbel . Die Zahl derselben ist anfangs sehr gering, nimmt
aber rasch zu, indem der Keim nach hinten sich verlängert
(Fig. 352—354, S. 711). Die ersten und ältesten Urwirbel sind
die vordersten Halswirbel; darauf entstehen die hinteren Halswirbel,
dann die vorderen Brustwirbel u. s. w. Zuletzt entstehen die
'hintersten Sch wanzwirbel. Dieses successive ontogenetische Wachstum
der Wirbelsäule in der Richtung von vorn nach hinten erklärt
sich phylogenetisch dadurch, daß wir das vielgliederige Wirbeltier
als ein sekundäres Produkt anzusehen haben, entstanden durch zunehmende
Metamerenbildung oder Vertebration aus einer ursprünglich
ungegliederten Stammform.
Wie wir schon früher mehrmals betont haben, besitzt diese
Ve r t e b r a t io n oder „innere Metamerenbildung“ eine sehr große
Bedeutung für die höhere morphologische und physiologische Entwickelung
der Wirbeltiere (vergl. S. 350, 561). Denn diese innere
Gliederung, gänzlich verschieden von der äußeren Artikulation der
Gliedertiere, beschränkt sich keineswegs auf die Wirbelsäule,
sondern trifft in gleichem Maße das Muskelsystem, Nervensystem,
Gefäßsystem u. s. w. Sie betrifft zuerst das Muskelsystem und
erscheint erst später am Skelettsystem. In der Tat ist ja jeder
sogenannte „Urwirbel“ viel mehr als bloß die Anlage eines späteren
Wirbels. Bloß der innerste, unmittelbar der Chorda und dem Markrohr
anliegende Teil desselben wird als Skierotom zur eigentlichen
„Wirbelbildung“ verwendet, während seine Hauptmasse die Muskelplatte
bildet (Mytom). Wie die eigentlichen Wirbel aus der Skelettplatte
der Urwirbel entstehen, haben wir früher schon gesehen.
Die ursprünglich getrennten, rechts und links von der Chorda gelegenen
Seitenhälften jedes Urwirbels treten miteinander in Verbindung.
Die unterhalb des Markrohrs zusammenkommenden
Bauchkanten beider Hälften umwachsen die Chorda und bilden so
die Grundlage der Wi rbe lk ö rpe r . Die oberhalb des Markrohrs
sich vereinigenden Rückenkanten beider Hälften bilden die
Anlage des oberen Wi rbelbogens . (Vergl. Fig. 148— 151, S. 333,
sowie Tafel VI, Fig. 3— 8.)
Bei allen Schädeltieren verwandeln sich die weichen, indifferenten
Zellen des Mesoderms, welche die Skelettplatte ursprünglich
zusammensetzen, später größtenteils in Knorpelzellen, welche
eine feste und elastische Zwischenmasse („Intercellularsubstanz“)
zwischen sich ausscheiden und Knorpelgewebe erzeugen. Gleich
den meisten anderen Skelettteilen gehen so auch die häutigen
Wirbelanlagen bald in einen knorpeligen Zustand über, und bei den
höheren Wirbeltieren tritt später an die Stelle des Knorpelgewebes
das starre Knochengewebe mit seinen eigentümlichen sternförmigen
Knochenzellen (Fig. 6, S. 114). Das primäre, ursprüngliche Achsenskelett
bleibt als einfache Chorda zeitlebens bestehen bei den
Acraniern, den Cyclostomen und den niedersten Fischen. Bei den
meisten übrigen Vertebraten wird die Chorda durch das ringsum
wuchernde Knorpelgewebe der sekundären Perichorda mehr oder
weniger verdrängt. Bei den niederen Schädeltieren (namentlich
Fischen) bleibt ein mehr oder weniger ansehnlicher Teil der Chorda
Fig- 397-
Eig. 397. Drei Brustwirbel
eines menschlichen Embryo von acht
Wochen, im lateralen Län g s s c h n i t t .
v knorpeliger Wirbelkörper, l i Zwischen-
■ wirbelscheiben, ck Chorda. Nach K ö lliker.
Fig. 398. Ein Brustwirbel desselben
Embryo, im lateralen Q u e r schni
t t . cv knorpeliger Wirbelkörper,
ch Chorda, frr Querfortsatz, a Wirbelbogen
(oberer Bogen), c oberes Ende der
Rippe (unterer Bogen). Nach K ölliker.
Fig. 398.
Fig. 399- Zw is ch enw irb e ls ch e ib e eines neugeborenen Kindes im Querschnitt
a Rest der Chorda. Nach K ö llik er.
in den Wirbelkörpern erhalten. Bei den Säugetieren hingegen
verschwindet sie zum größten Teile. Schon am Ende des zweiten
Monats erscheint die Chorda beim menschlichen Embryo nur als
ein dünner Faden, welcher durch die Achse der dicken, knorpeligen
Wirbelsäule hindurchzieht (Fig. 194 ch, 397 ch). In den knorpeligen
Wirbelkörpern selbst, die später verknöchern, verschwindet der
dünne Chordarest bald gänzlich (Fig 398 ch). In den elastischen
„Zwischenwirbelscheiben“ hingegen, welche sich zwischen je zwei
Wirbelkörpern aus der Skelettplatte entwickeln (Fig. 397 li), bleibt
ein Rest der Chorda zeitlebens bestehen. Beim neugeborenen Kinde