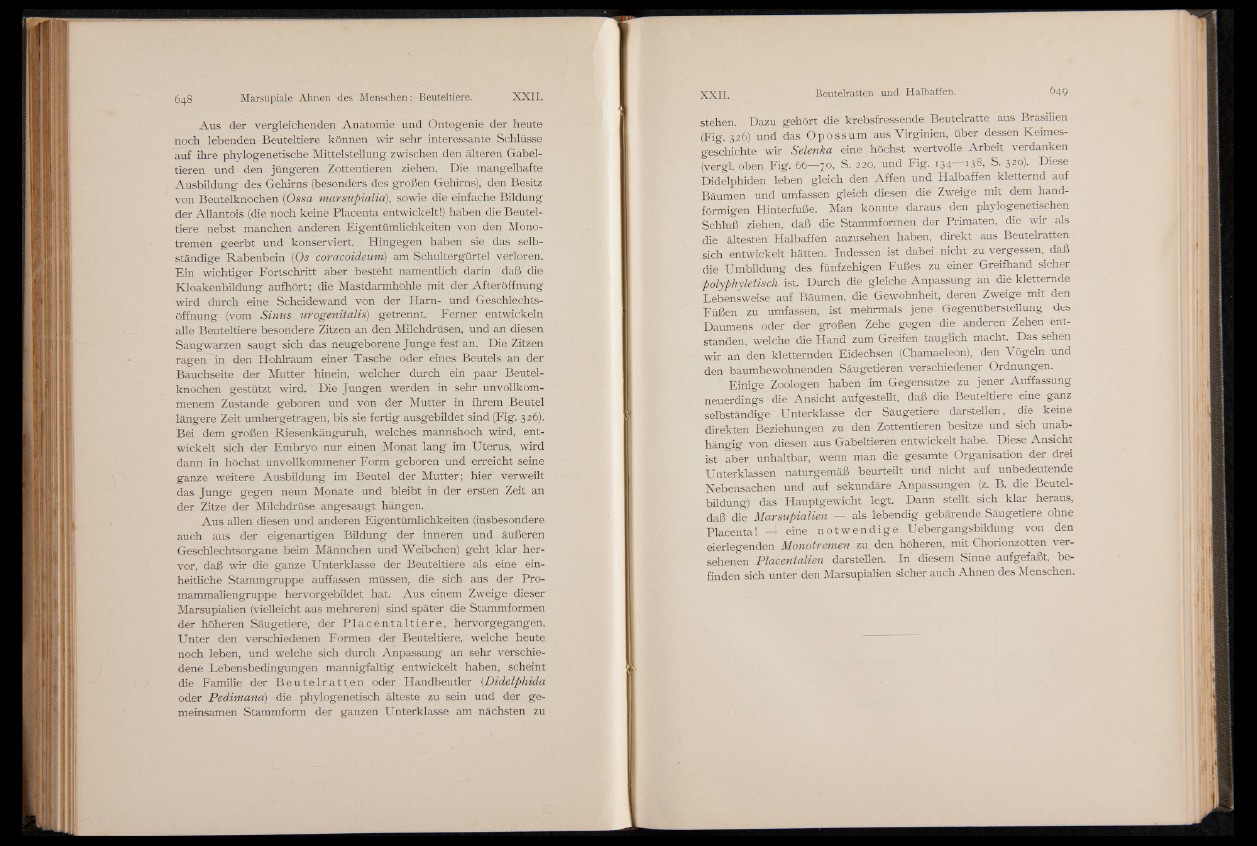
Aus der vergleichenden Anatomie und Ontogenie der heute
noch lebenden Beuteltiere können wir sehr interessante Schlüsse
auf ihre phylogenetische Mittelstellung zwischen den älteren Gabeltieren
und den jüngeren Zottentieren ziehen. Die mangelhafte.
Ausbildung des Gehirns (besonders des großen Gehirns), den Besitz
von Beutelknochen (Ossa marsupialia), sowie die einfache Bildung
der Allantois (die noch keine Placenta entwickelt!) haben die Beuteltiere
nebst manchen anderen Eigentümlichkeiten von den Mono-
tremen geerbt und konserviert. Hingegen haben sie das selbständige
Rabenbein (Os coracoideum) am Schultergürtel verloren.
Ein wichtiger Fortschritt aber besteht namentlich darin daß die
Kloakenbildung aufhört; die Mastdarmhöhle mit der Afteröffnung
wird durch eine Scheidewand von der Harn- und Geschlechts-
öffnung (vom Sinus urogenitalis) getrennt. Ferner entwickeln
alle Beuteltiere besondere Zitzen an den Milchdrüsen, und an diesen
Saugwarzen saugt sich das neugeborene Junge fest an. Die Zitzen
ragen in den Hohlraum einer Tasche oder eines Beutels an der
Bauchseite der Mutter hinein, welcher durch ein paar Beutelknochen
gestützt wird. Die Jungen werden in sehr unvollkommenem
Zustande geboren und von der Mutter in ihrem Beutel
längere Zeit umhergetragen, bis sie fertig ausgebildet sind (Fig. 326).
Bei dem großen Riesenkänguruh, welches mannshoch wird, entwickelt
sich der Embryo nur einen Monat lang im Uterus, wird
dann in höchst unvollkommener Form geboren und erreicht seine
ganze weitere Ausbildung im Beutel der Mutter; hier verweilt
das Junge gegen neun Monate und bleibt in der ersten Zeit an
der Zitze der Milchdrüse angesaugt hängen. .
Aus allen diesen und anderen Eigentümlichkeiten (insbesondere
auch aus der eigenartigen Bildung der inneren und äußeren
Geschlechtsorgane beim Männchen und Weibchen) geht klar hervor,
daß wir die ganze Unterklasse der Beuteltiere als eine einheitliche
Stammgruppe auffassen müssen, die sich aus der Promammaliengruppe
hervorgebildet hat. Aus einem Zweige dieser
Marsupialien (vielleicht aus mehreren) sind später die Stammformen
der höheren Säugetiere, der Pla c enta l t ie r e , hervorgegangen.
Unter den verschiedenen Formen der Beuteltiere, welche heute
noch leben, und welche sich durch Anpassung an sehr verschiedene
Lebensbedingungen mannigfaltig entwickelt haben, scheint
die Familie der Beut e l r a t t en oder Handbeutler (Didelphida
oder Pedimana) die phylogenetisch älteste zu sein und der gemeinsamen
Stammform der ganzen Unterklasse am nächsten zu
stehen. Dazu gehört die krebsfressende Beutelratte aus Brasilien
(Fig. 326) und das Opossum aus Virginien, über dessen Keimesgeschichte
wir Selenka eine höchst wertvolle Arbeit verdanken
(vergl. oben Fig. 66— yo, S. 220, und Fig. 134 138, S. 320). Diese
Didelphiden leben gleich den Affen und Halbaffen kletternd auf
Bäumen und umfassen gleich diesen die Zweige mit dem handförmigen
Hinterfuße. Man könnte daraus den phylogenetischen
Schluß ziehen, daß die Stammformen der Primaten, die wir als
die ältesten Halbaffen anzusehen haben, direkt aus Beutelratten
sich entwickelt hätten. Indessen ist dabei nicht zu vergessen, daß
die Umbildung des fünfzehigen Fußes zu einer Greifhand sicher
polyphyletisch ist. Durch die gleiche Anpassung an die kletternde
Lebensweise auf Bäumen, die Gewohnheit, deren Zweige mit den
Füßen zu umfassen, ist mehrmals jene Gegenüberstellung des
Daumens oder der großen Zehe gegen die anderen Zehen entstanden,
welche die Hand zum Greifen tauglich macht. Das sehen
wir an den kletternden Eidechsen (Chamaeleon), den Vögeln und
den baumbewohnenden Säugetieren verschiedener Ordnungen.
' Einige Zoologen haben im Gegensätze zu jener Auffassung
neuerdings die Ansicht aufgestellt, daß die Beuteltiere eine ganz
selbständige Unterklasse der Säugetiere darstellen, die keine
direkten Beziehungen zu den Zottentieren besitze und sich unabhängig
von diesen aus Gabeltieren entwickelt habe. Diese Ansicht
ist aber unhaltbar, wenn man die gesamte Organisation der drei
Unterklassen naturgemäß beurteilt und nicht auf unbedeutende
Nebensachen und auf sekundäre Anpassungen (z. B. die Beutelbildung)
das Hauptgewicht legt. Dann stellt sich klar heraus,
daß die Marsupialien — als lebendig gebärende Säugetiere ohne
Placenta! — eine no twend ig e Uebergangsbildung von den
eierlegenden Monotremen zu den höheren, mit Chorionzotten versehenen
Placentalien darstellen. In diesem Sinne aufgefaßt, befinden
sich unter den Marsupialien sicher auch Ahnen des Menschen.