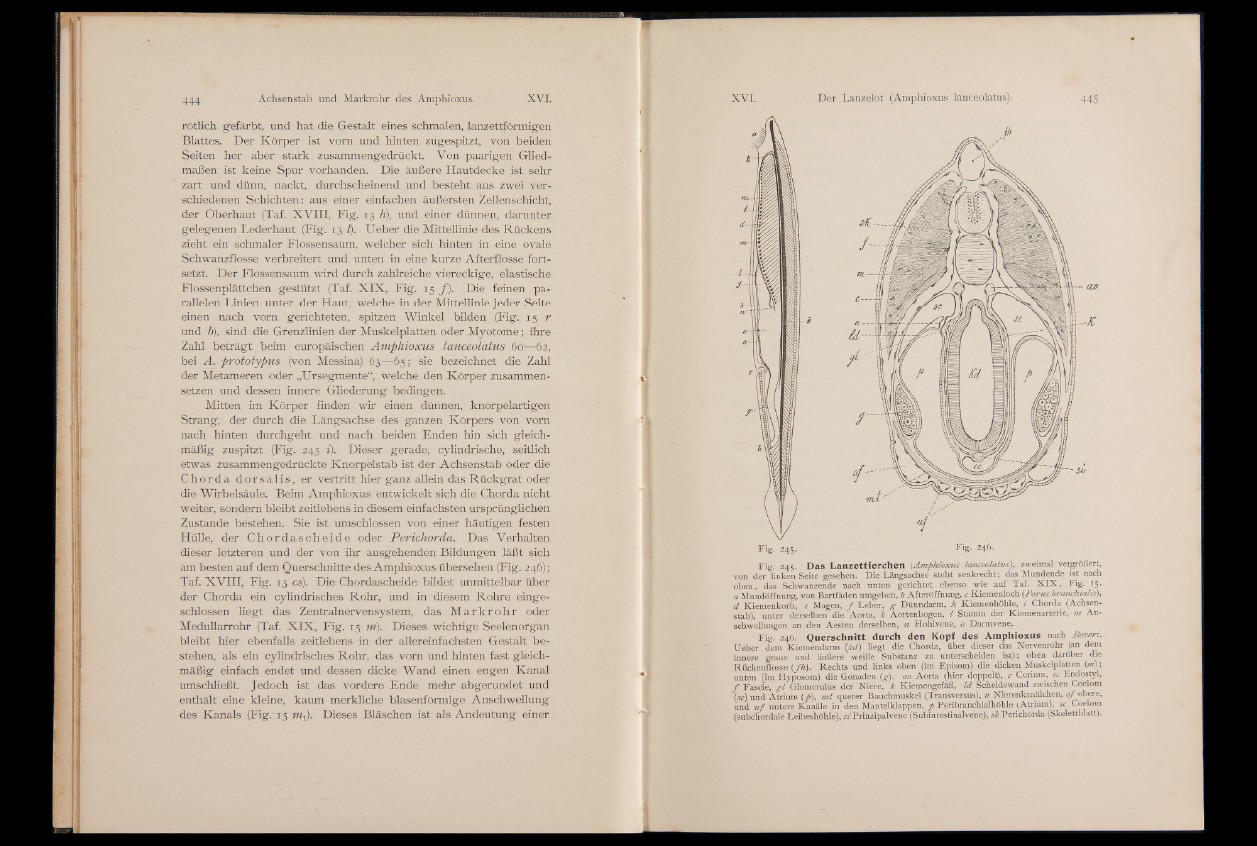
rötlich gefärbt, und hat die Gestalt'eines schmalen, lanzettförmigen
Blattes. Der Körper ist vorn und hinten zugespitzt, von beiden
Seiten her aber stark zusammengedrückt. Von paarigen Gliedmaßen
ist keine Spur vorhanden. Die äußere Hautdecke ist sehr
zart und dünn, nackt, durchscheinend und besteht aus zwei verschiedenen
Schichten: aus einer einfachen äußersten Zellenschicht,
der Oberhaut (Taf. XVIII, Fig. 13 h), und einer dünnen, darunter
gelegenen Lederhaut (Fig. 13 t). Ueber die Mittellinie des Rückens
zieht ein schmaler Flossensaum, welcher sich hinten in eine ovale
Schwanzflosse verbreitert und unten in eine kurze Afterflosse fortsetzt.
Der Flossensaum wird durch zahlreiche viereckige, elastische
Flossenplättchen gestützt (Taf. XIX, Fig. 15 ƒ). Die feinen parallelen
Linien unter der Haut, welche in der Mittellinie jeder Seite
einen nach vorn gerichteten, spitzen Winkel bilden (Fig. 15 r
und b), sind die Grenzlinien der Muskelplatten oder Myotome; ihre
Zahl beträgt beim europäischen Amphioxus lanceolatus 6o-—6z,
bei A. prototypus (von Messina) 63=—65; sie bezeichnet die Zahl
der Metameren oder „Ursegmente“, welche den Körper zusammensetzen
und dessen innere Gliederung bedingen.
Mitten im Körper finden wir einen dünnen, knorpelartigen
Strang, der durch die Längsachse des ganzen Körpers von vorn
nach hinten durchgeht und nach beiden Enden hin sich gleichmäßig
zuspitzt (Fig. 245 £). Dieser gerade, cylindrische, seitlich
etwas zusammengedrückte Knorpelstab ist der Achsenstab oder die
Chorda dorsal i s , er vertritt hier ganz allein das Rückgrat oder
die Wirbelsäule. Beim Amphioxus entwickelt sich die Chorda nicht
weiter, sondern bleibt zeitlebens in diesem einfachsten ursprünglichen
Zustande bestehen- Sie ist umschlossen von einer häutigen festen
Hülle, der Chorda s che ide oder Perichorda. Das Verhalten
dieser letzteren und der von ihr ausgehenden Bildungen läßt sich
am besten auf dem Querschnitte des Amphioxus übersehen (Fig. 246);
Taf. XVIII, Fig. 13 cs). Die Chordascheide bildet unmittelbar über
der Chorda ein cylindrisches Rohr, und in diesem Rohre eingeschlossen
liegt das Zentralnervensystem, das Ma rkrohr oder
Medullarrohr (Taf. XIX, Fig. 15 m). Dieses wichtige Seelenorgan
bleibt hier ebenfalls zeitlebens in der allereinfachsten Gestalt bestehen,
als ein cylindrisches Rohr, das vorn und hinten fast gleichmäßig
einfach endet und dessen dicke Wand einen engen Kanal
umschließt. Jedoch ist das vordere Ende mehr abgerundet und
enthält eine kleine, kaum merkliche blasenförmige Anschwellung
des Kanals (Fig.15 mP). - Dieses Bläschen ist als Andeutung einer
Fig. 246. Querschnitt durch den Kopf des Amphioxus nach Boveri.
Ueber dem Kiemendarm (M ) liegt die Chorda, über dieser das Nervenrohr (an dem
innere graue und äußere weiße Substanz zu unterscheiden ist); oben darüber die
Rückenflosse (fh ). Rechts und links oben (im Episom) die dicken Muskelplatten (m);
unten (im Hyposom) die Gonaden (g). ao Aorta (hier doppelt), c Corium, ec Endostyl,
f Fascie, g l Glomerulus der Niere, k Kiemengefäß, Id Scheidewand zwischen Coelom
fa) und Atrium (p ), m t querer Bauchmuskel (Transversus), n Nierenkanälchen, o f obere,
und u f untere Kanäle in den Mantelklappen, p Peribranchialhöhle (Atrium), sc Coelom
(subchordale Leibeshöhle), s i Prinzipalvene (Subintestinalvene), sk Perichorda (Skelettblatt).