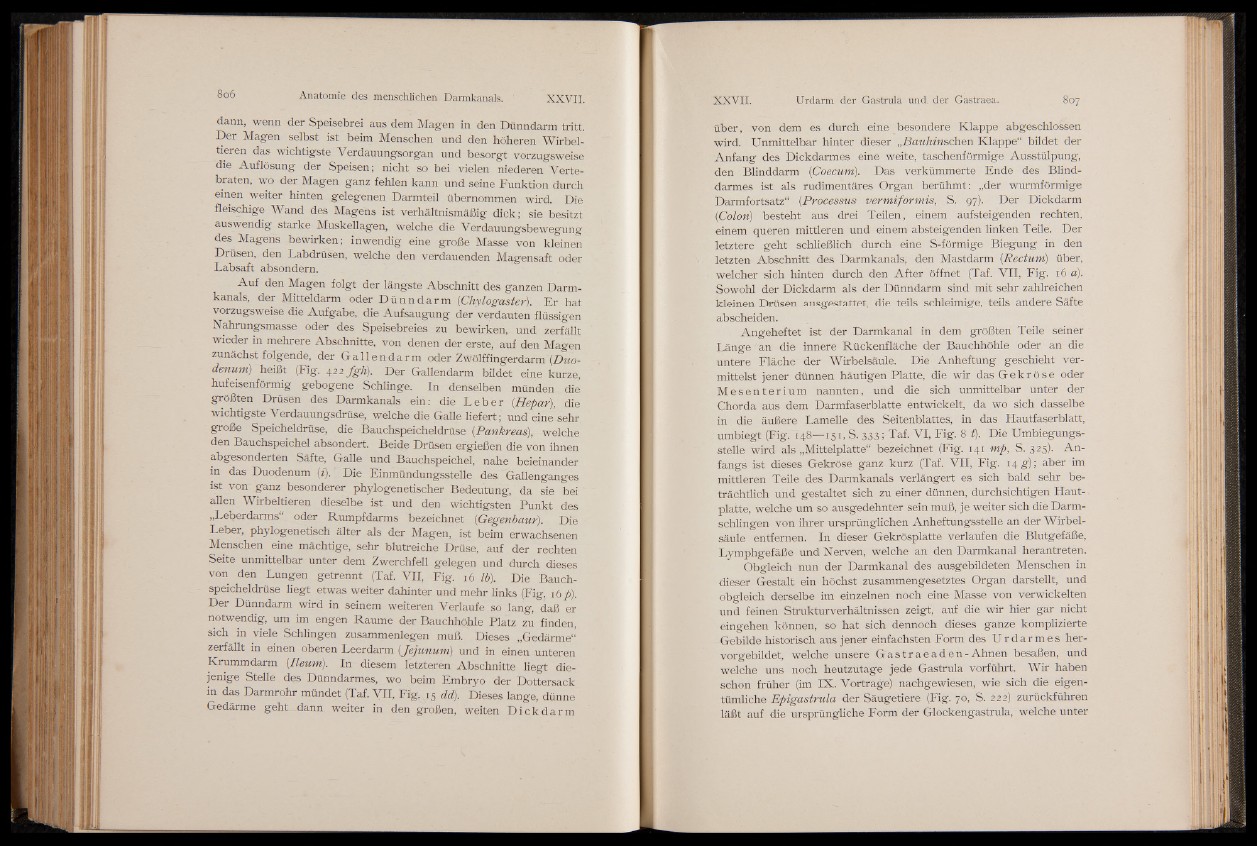
dann, wenn der Speisebrei aus dem Magen in den Dünndarm tritt.
Der Magen selbst ist beim Menschen und den höheren Wirbeltieren
das wichtigste Verdauungsorgan und besorgt vorzugsweise
die Auflösung der Speisen; nicht so bei vielen niederen Vertebraten,
wo der Magen ganz fehlen kann und seine Funktion durch
einen weiter hinten gelegenen Darmteil übernommen wird. Die
fleischige Wand des Magens ist verhältnismäßig dick; sie besitzt
auswendig starke Muskellagen, welche die Verdauungsbewegung
des Magens bewirken; inwendig eine große Masse von kleinen
Drüsen, den Labdrüsen, welche den verdauenden Magensaft oder
Labsaft absondern.
Auf den Magen folgt der längste Abschnitt des ganzen Darmkanals,
der Mitteldarm oder Dünndarm (Chylogaster). Er hat
vorzugsweise die Aufgabe, die Aufsaugung der verdauten flüssigen
Nahrungsmasse oder des Speisebreies zu bewirken, und zerfällt
wieder in mehrere Abschnitte, von denen der erste, auf den Magen
zunächstfolgende, der Gal lendarm oder Zwölffingerdarm (Duodenum)
heißt (Fig. 42 2 fgh). Der Gallendarm bildet eine kurze,
hufeisenförmig gebogene Schlinge. In denselben münden die
größten Drüsen des Darmkanals ein: die Leb e r (Hepar), die
wichtigste Verdauungsdrüse, welche die Galle liefert; und eine sehr
große Speicheldrüse, die Bauchspeicheldrüse (Pankreas), welche
den Bauchspeichel absondert. Beide Drüsen ergießen die von ihnen
abgesonderten Säfte, Galle und Bauchspeichel, nahe beieinander
in das Duodenum (z). Die Einmündungsstelle des 'Gallenganges
ist von ganz besonderer phylogenetischer Bedeutung, da sie bei
allen Wirbeltieren dieselbe ist und den wichtigsten Punkt des
„Leberdarms“ oder Rumpfdarms bezeichnet (Gegenbaur). Die
Leber, phylogenetisch älter als der Magen, ist beim erwachsenen
Menschen eine mächtige, sehr blutreiche Drüse, auf der rechten
Seite unmittelbar unter dem Zwerchfell gelegen und durch dieses
von den Lungen getrennt (Taf. VII, Fig. 16 Ib), Die Bauchspeicheldrüse
hegt etwas weiter dahinter und mehr links (Fig. 16 p).
Der Dünndarm wird in seinem weiteren Verlaufe so lang, daß er
notwendig, um im engen Raume der Bauchhöhle Platz zu finden,
sich in viele Schlingen Zusammenlegen muß. Dieses „Gedärme“
zerfällt in einen oberen Leerdarm (Jejunum) und in einen unteren
Krummdarm (Ileuni). In diesem letzteren Abschnitte liegt diejenige
Stehe des Dünndarmes, wo beim Embryo der Dottersack
in das Darmrohr mündet (Taf. VII, Fig, 15 ^ .'D ie s e s lange, dünne
Gedärme geht_dann weiter in den großen, weiten Di ck dar m
über, von dem es durch eine besondere Klappe abgeschlossen
wird. Unmittelbar hinter dieser „Bauhinschen Klappe“ bildet der
Anfang des Dickdarmes eine weite, taschenförmige Ausstülpung,
den Bhnddarm (Coecum). Das verkümmerte Ende des Blinddarmes
ist als rudimentäres Organ berühmt: „der wurmförmige
Darmfortsatz“ (Processus vermiformis, S. 97). Der Dickdarm
(Co/o«)pbesteht aus drei Teilen, einem aufsteigenden rechten,
einem queren mittleren und einem absteigenden linken Teile. Der
letztere geht schließlich durch eine S-förmige Biegung in den
letzten Abschnitt des Darmkanals, den Mastdarm (Rectum) über,
welcher sich hinten durch den After öffnet (Taf. VII, Fig. 16 a).
Sowohl der Dickdarm als der Dünndarm sind mit sehr zahlreichen
kleinen Drüsen ausgestattet, die teils schleimige, teils andere Säfte
abscheiden.
Angeheftet ist der Darmkanal in dem größten Teile seiner
Länge 'an die innere Rückenfläche der Bauchhöhle oder an die
untere Fläche der Wirbelsäule. Die Anheftung geschieht vermittelst
jener dünnen häutigen Platte, die wir das Gekrös e oder
Me senter ium nannten, und die sich unmittelbar unter der
Chorda aus dem Darmfaserblatte entwickelt, da wo sich dasselbe
in die äußere Lamelle des Seitenblattes, in das Hautfaserblatt,
umbiegt (Fig. 148^151, S. 333; Taf. VI, Fig. 8 t). Die Umbiegungsstelle
wird als „Mittelplatte“ bezeichnet (Fig. 141 mp, S. 325). Anfangs
ist dieses Gekröse ganz kurz (Taf. VII, Fig. 14g); aber im
mittleren Teile des Darmkanals verlängert es sich bald sehr beträchtlich
und gestaltet sich zu einer dünnen, durchsichtigen Häutplatte,
welche um so ausgedehnter sein muß; je weiter sich die Darmschlingen
von ihrer ursprünglichen Anheftungsstelle an der Wirbelsäule
entfernen. In dieser Gekrösplatte verlaufen die Blutgefäße,
Lymphgefäße und Nerven, welche an den Darmkanal herantreten.
Obgleich nun der Darmkanal des ausgebildeten Menschen in
dieser Gestalt ein höchst zusammengesetztes Organ darstellt, und
obgleich derselbe im einzelnen noch eine Masse von verwickelten
und feinen Strukturverhältnissen zeigt, auf die wir hier gar nicht
eingehen können, so hat sich dennoch dieses ganze komplizierte
Gebilde historisch aus jener einfachsten Form des Urda rme s hervorgebildet,
welche unsere Gästraeaden-Ahnen besaßen, und
welche uns noch heutzutage jede Gastrula vorführt. Wir haben
schon früher (im IX. Vortrage) nachgewiesen, wie sich die eigentümliche
Epigastrula der Säugetiere (Fig. 70, S. 222) zurückführen
läßt auf die ursprüngliche Form der Glockengastrula, welche unter