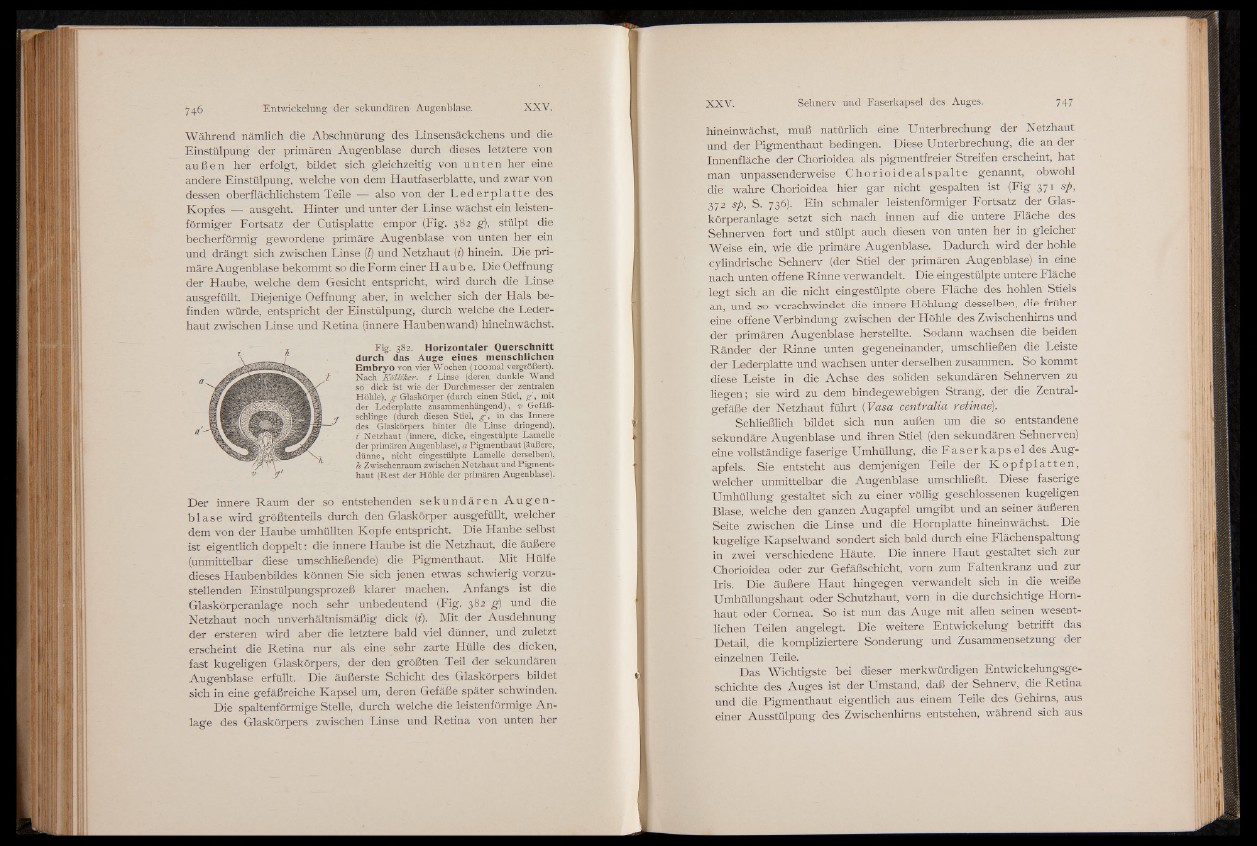
Während nämlich die Abschnürung des Linsensäckchens und die
Einstülpung der primären Augenblase durch dieses letztere von
außen her erfolgt, bildet sich gleichzeitig von unten her eine
andere Einstülpung, welche von dem Hautfaserblatte, und zwar von
dessen oberflächlichstem Teile — also von der Lederplat te des
Kopfes -li ausgeht. Hinter und unter der Linse wächst ein leistenförmiger
Fortsatz der Cutisplatte empor (Fig. 382 g), stülpt die
becherförmig gewordene primäre Augenblase von unten her ein
und drängt sich zwischen Linse (!) und Netzhaut (i) hinein. Die primäre
Augenblase bekommt so die Form einer Haube. Die Oeffnung
der Haube, welche dem Gesicht entspricht, wird durch die Linse
ausgefüllt. Diejenige Oeffnung aber, in welcher sich der Hals befinden
würde, entspricht der Einstülpung, durch welche die Lederhaut
zwischen Linse und Retina (innere Haubenwand) hineinwächst.
Fig. 382. Horizontaler Querschnitt
durch das Auge eines menschlichen
Embryo von vier Wochen (loomal vergrößert).
Nach K ö llik er. t Linse (deren dunkle Wand
so dick ist wie der Durchmesser der zentralen
Höhle), g Glaskörper (durch einen Stiel, g , mit
der Lederplatte zusammenhängend), v Gefäßschlinge
(durch diesen Stiel, g , in das Innere
des Glaskörpers hinter die Linse dringend),
i Netzhaut (innere, dicke, eingestülpte Lamelle
der primären Augenblase), a Pigmentbaut (äußere,
dünne, nicht eingestülpte Lamelle derselben),
h Zwischenraum zwischen Netzhaut und Pigmenthaut
(Rest der Höhle der primären Augenblase).
Der innere Raum der so entstehenden sekundären A u g e n blase
wird größtenteils durch den Glaskörper ausgefüllt, welcher
dem von der Haube umhüllten Kopfe entspricht. Die Haube selbst
ist eigentlich doppelt: die innere Haube ist die Netzhaut, die äußere
(unmittelbar diese umschließende) die Pigmenthaut. Mit Hülfe
dieses Haubenbildes können Sie sich jenen etwas schwierig vorzustellenden
Einstülpungsprozeß klarer machen. Anfangs ist die
Glaskörperanlage noch sehr unbedeutend (Fig. 382 g) und die
Netzhaut noch unverhältnismäßig dick {i). Mit der Ausdehnung
der ersteren wird aber die letztere bald viel dünner, und zuletzt
erscheint die Retina nur als eine sehr zarte Hülle des dicken,
fast kugeligen Glaskörpers, der den größten Teil der sekundären
Augenblase erfüllt. Die äußerste Schicht des Glaskörpers bildet
sich in eine gefäßreiche Kapsel um, deren Gefäße später schwinden.
Die spaltenförmige Stelle, durch welche die leistenförmige Anlage
des Glaskörpers zwischen Linse und Retina von unten her
hineinwächst, muß natürlich eine Unterbrechung der Netzhaut
und der Pigmenthaut bedingen. Diese Unterbrechung, die an der
Innenfläche der Chorioidea als pigmentfreier Streifen erscheint, hat
man unpassenderw'eise Chor ioidealspal te genannt, obwohl
die wahre Chorioidea hier gar nicht gespalten ist (Fig 371 sp,
372 sp, S. 736). Ein schmaler leistenförmiger Fortsatz der Glaskörperanlage
setzt sich nach innen auf die untere Fläche des
Sehnerven fort und stülpt auch diesen von unten her in gleicher
Weise ein, wie die primäre Augenblase, Dadurch wird der hohle
cylindrische Sehnerv (der Stiel der primären Augenblase) in eine
nach unten offene Rinne verwandelt. Die eingestülpte untere Fläche
legt sich an die nicht eingestülpte obere Fläche des hohlen Stiels
an, und so verschwindet die innere Höhlung desselben, die früher
eine offene Verbindung zwischen der Höhle des Zwischenhirns und
der primären Augenblase herstellte. . Sodann wachsen die beiden
Ränder der Rinne unten gegeneinander, umschließen die Leiste
der Lederplatte und wachsen unter derselben zusammen. So kommt
diese Leiste in die Achse des soliden sekundären Sehnerven zu
liegen; sie wird zu dem bindegewebigen Strang, der die Zentralgefäße
der Netzhaut führt (Vasa centralia retinae).
Schließlich bildet sich nun außen um die so entstandene
sekundäre Augenblase und ihren Stiel (den sekundären Sehnerven)
eine vollständige faserige Umhüllung, die Fa s e rkaps e l des Augapfels.
Sie entsteht aus demjenigen Teile der Ko p fp l a t t en ,
welcher unmittelbar die Augenblase umschließt. Diese faserige
Umhüllung gestaltet sich zu einer völlig geschlossenen kugeligen
Blase, welche den ganzen Augapfel umgibt und an seiner äußeren
Seite zwischen die Linse und die Hornplatte hineinwächst. Die
kugelige Kapselwand sondert sich bald durch eine Flächenspaltung
in zwei verschiedene Häute. Die innere Haut gestaltet sich zur
Chorioidea oder zur Gefäßschicht, vorn zum Faltenkranz und zur
Iris. Die äußere Haut hingegen verwandelt sich in die weiße
Umhüllungshaut oder Schutzhaut, vorn in die durchsichtige Hornhaut
oder Cornea. So ist nun das Auge mit allen seinen wesentlichen
Teilen angelegt. Die ^weitere Entwickelung betrifft das
Detail, die kompliziertere Sonderung und Zusammensetzung der
einzelnen Teile.
Das Wichtigste bei dieser merkwürdigen Entwickelungsgeschichte
des Auges ist der Umstand, daß der Sehnerv, die Retina
und die Pigmenthaut eigentlich aus einem Teile des Gehirns, aus
einer Ausstülpung des Zwischenhirns entstehen, während sich aus