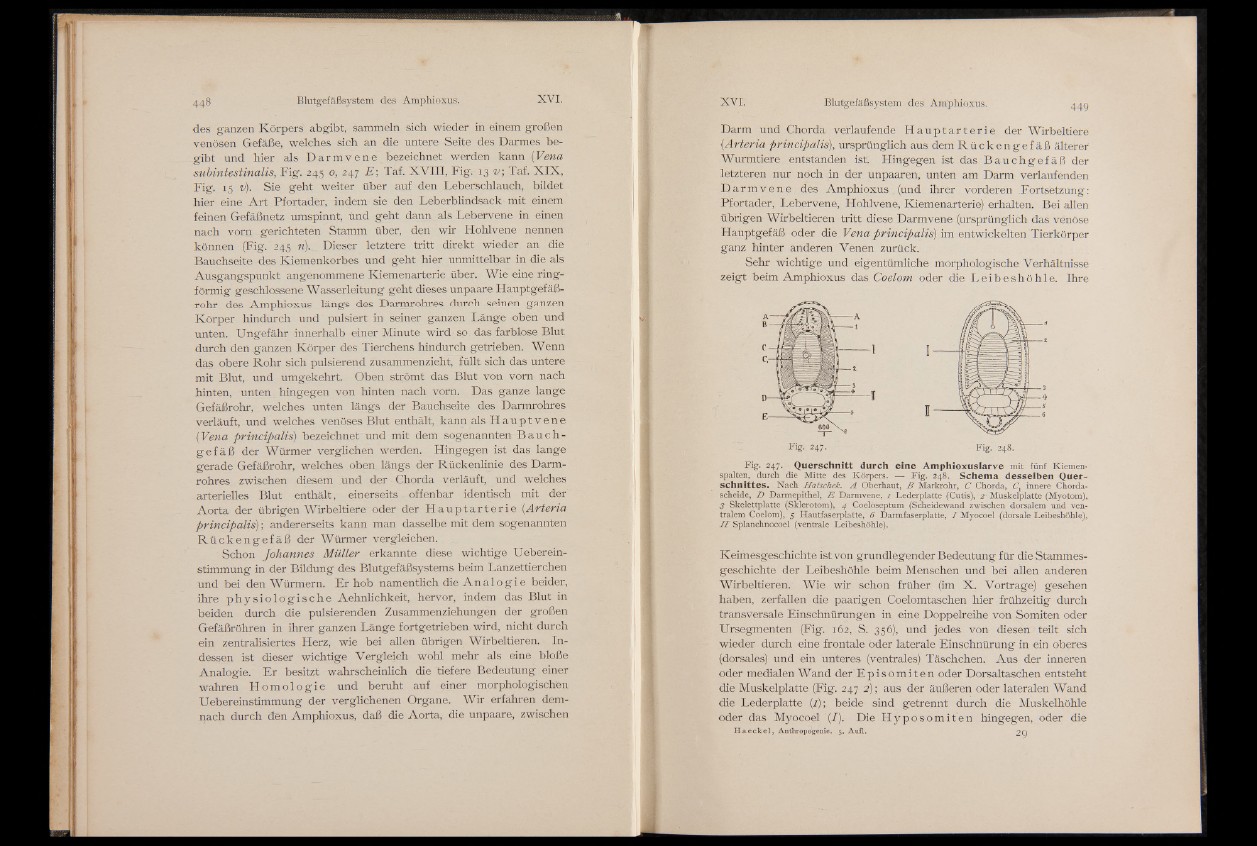
des ganzen Körpers abgibt, sammeln sich wieder in einem großen
venösen Gefäße, welches sich an die untere Seite des Darmes begibt
und hier als Da rmv ene bezeichnet werden kann (Vena
subintestinalis, Fig. 245 o, 247 E; Taf. XVIII, Fig. 13 v; Taf. XIX,
Fig. 15 v). Sie geht weiter über auf den Leberschlauch, bildet
hier eine Art Pfortader, indem sie den Leberblindsack > mit einem
feinen Gefäßnetz umspinnt, und geht dann als Lebervene in einen
nach vorn .gerichteten Stamm über, den wir Hohlvene nennen
können (Fig. 245 n). Dieser letztere tritt direkt wieder an die
Bauchseite des Kiemenkorbes und geht hier unmittelbar in die als
Ausgangspunkt angenommene Kiemenarterie über. Wie eine ringförmig
geschlossene Wasserleitung geht dieses unpaare Hauptgefäßrohr
des Amphioxus längs des Darmrohres durch seinen ganzen
Körper hindurch und pulsiert in seiner ganzen Länge oben und
unten. Ungefähr innerhalb einer Minute wird’ so. das farblose Blut
durch den .ganzen Körper des Tierchens hindurch getrieben. Wenn
das obere Rohr sich pulsierend zusammenzieht, füllt sich das untere
mit Blut, und umgekehrt. Oben strömt das Blut von vorn nach
hinten, unten hingegen von hinten nach vom. Das ganze lange
Gefäßrohr, welches unten längs der Bauchseite des Darmrohres
verläuft, und welches venöses Blut enthält, kann als Haupt v ene
(Vena principalis) bezeichnet und mit dem sogenannten B a u c h g
e f ä ß der Würmer verglichen werden. Hingegen ist das lange
gerade Gefäßrohr, welches oben längs der Rückenlinie des Darmrohres
zwischen diesem und der Chorda verläuft, und welches
arterielles Blut enthält, einerseits offenbar identisch mit der
Aorta der übrigen Wirbeltiere oder der Haupt a r t e r ie (Arteria
principalis)-, andererseits kann man dasselbe mit dem sogenannten
R ü c k e n g e f ä ß der Würmer vergleichen. ,
Schon Johannes Müller erkannte diese wichtige Ueberein-
stimmung in der Bildung des Blutgefäßsystems beim Lanzettierchen
und bei den Würmern. Er hob namentlich die An a lo g i e beider,
ihre phys iol c fg i s che Aehnlichkeit, hervor, indem das Blut in
beiden durch die pulsierenden Zusammenziehungen der großen
Gefäßröhren in ihrer ganzen Länge fortgetrieben wird, nicht durch
ein zentralisiertes Herz, wie bei allen übrigen Wirbeltieren. Indessen
ist dieser wichtige Vergleich wohl mehr als eine bloße
Analogie. Er besitzt wahrscheinlich die tiefere Bedeutung einer
wahren Homo lo g ie und beruht auf einer morphologischen
Uebereinstimmung der verglichenen Organe. Wir erfahren demnach
durch den Amphioxus, daß die Aorta, die unpaare, zwischen
Darm und Chorda verlaufende Haupt a r t e r ie der Wirbeltiere
(Arteria principalis), ursprünglich aus dem R ü c k e n g e f ä ß älterer
Wurmtiere entstanden ist. Hingegen ist das Bau ch g e f ä ß der
letzteren nur noch in der unpaaren, unten am Darm verlaufenden
Da rmv ene des Amphioxus(und ihrer vorderen Fortsetzung:
Pfortader, Lebervene, Hohlvene, Kiemenarterie) erhalten. Bei allen
übrigen Wirbeltieren tritt diese Darmvene (ursprünglich das venöse
Hauptgefäß oder die Vena principalis) im entwickelten Tierkörper
ganz hinter anderen Venen zurück.
Sehr wichtige und eigentümliche morphologische Verhältnisse
zeigt beim Amphioxus das Coelom oder die Leibeshöhle. Ihre
Fig. 247. Querschnitt durch eine Amphioxuslarve mit fünf Kiemenspalten,
durch die Mitte des Körpers. — Fig. 248. Schema desselben Querschnittes.
Nach Hatschek. A Oberhaut, B Markrohr, C Chorda, C, innere Chordascheide,
D Darmepithel, E Darmvene, 1 Lederplatte (Cutis), 2• Müskelplatte (Myotom),
3 Skelettplatte (Sklerotom), 4 Coelöseptum (Scheidewand zwischen dorsalem und ventralem
Coelom), 5 Hautfaserplatte, 6 Darmfaserplatte, I Myocoel (dorsale Leibeshöhle),
I I Splanchnocoel (ventrale Leibeshöhle).
Keimesgeschichte ist von grundlegender Bedeutung für die Stammesgeschichte
der Leibeshöhle beim Menschen und bei allen anderen
Wirbeltieren. Wie wir schon früher (im X. Vortrage) gesehen
haben, zerfallen die paarigen Coelomtaschen hier frühzeitig durch
transversale Einschnürungen in eine Doppelreihe von Somiten oder
Ursegmenten (Fig. 162, S. 356), und jedes von diesen teilt sich
wieder durch eine frontale öder laterale Einschnürung in ein oberes
(dorsales) und ein unteres (ventrales) Täschchen. Aus der inneren
oder medialen Wand der Episomi ten oder Dorsaltaschen entsteht
die Muskelplatte (Fig. 247 2); aus der äußeren oder lateralen Wand
die Lederplatte (/); beide sind getrennt durch die Muskelhöhle
oder das Myocoel '(/). Die Hyposomi ten hingegen, oder die
H a e ck e l, Anthropogenie. 5. Aufl. 20