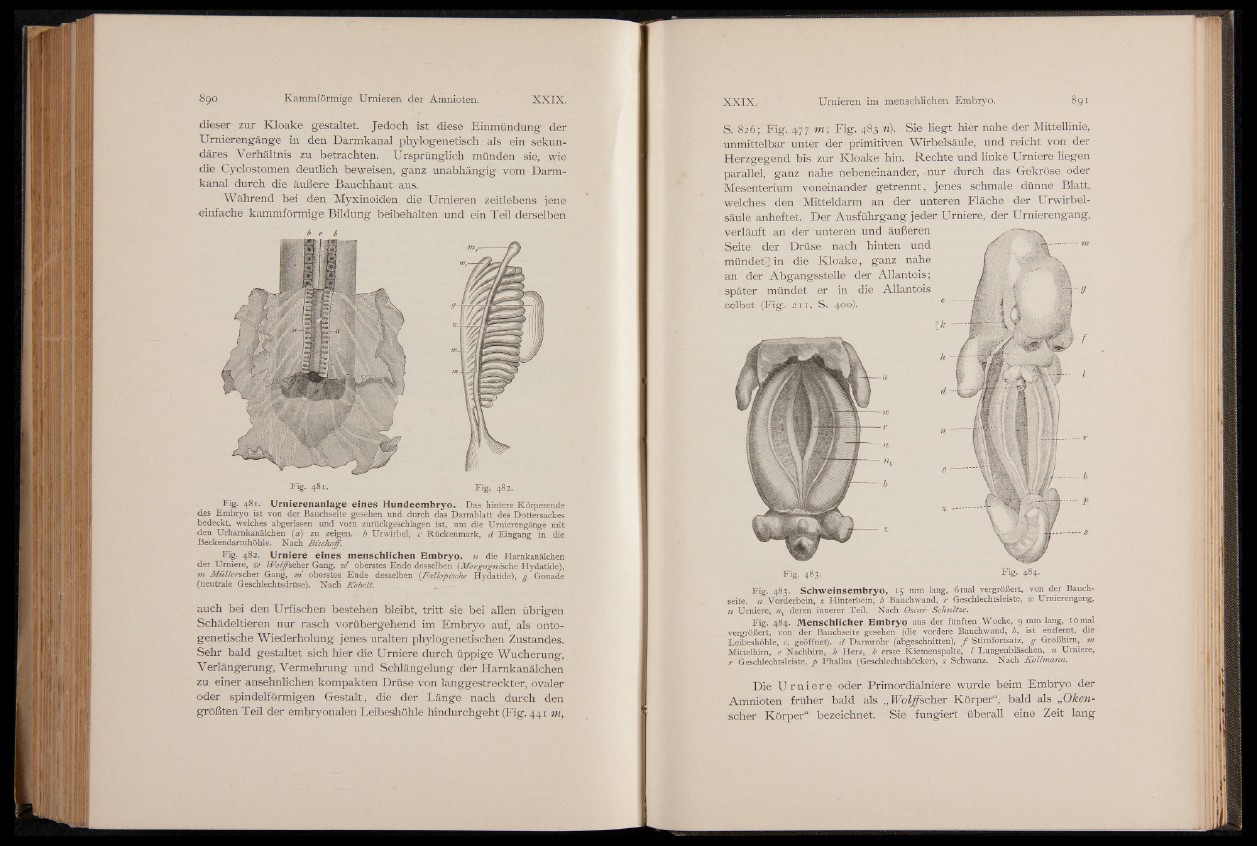
dieser zur Kloake gestaltet. Jedoch ist diese Einmündung der
Urnierengänge in den Darmkänal phylogenetisch als ein sekundäres
Verhältnis zu betrachten. Ursprünglich münden sie, wie
die Cyclostomen deutlich beweisen, ganz unabhängig vom Darmkanal
durch die äußere Bauchhaut aus.
Während bei den Myxinoiden die Urnieren zeitlebens jene
einfache kammförmige Bildung beibehalten und ein Teil derselben
b e i
Fig. 481. Fig. 482.
Fig. 481. Urnierenanlage eines Hundeembryo. Das hintere Körperende
des Embryo ist von der Bauchseite gesehen und durch das Darmblatt des Dottersackes
bedeckt, welches abgerissen und vom zurückgeschlagen ist, um die Urnierengänge mit
den Urhamkanälchen (a) zu -zeigen, b Urwirbel, c Rückenmark, d Eingang in die
Beckendarmhöhle. Nach BüchojJ.
Fig. 482. Urniere eines menschlichen Embryo, u die Harnkanälchen
der Umiere, w Wölfischer Gang, w oberstes Ende desselben (Morgagntsche Hydatide),
m MüllerscheT Gang, m oberstes Ende desselben (Fallopische Hydatide), g Gonade
(neutrale Geschlechtsdrüse). Nach Kobelt.
auch bei den Urfischen bestehen bleibt, tritt sie bei allen übrigen
Schädeltieren nur rasch vorübergehend im Embryo auf, als onto-
genetische Wiederholung jenes uralten phylogenetischen Zustandes.
Sehr bald gestaltet sich hier die Urniere durch üppige Wucherung,
Verlängerung, Vermehrung und Schlängelung der Harnkanälchen
zu einer ansehnlichen kompakten Drüse von langgestreckter, ovaler
oder spindelförmigen Gestalt, die der Länge nach durch den
größten Teil der embryonalen Leibeshöhle hindurchgeht (Fig. 441 m,
S, 826; Fig. 477 m; Fig. 483 n). Sie liegt hier nahe der Mittellinie,
unmittelbar unter der primitiven Wirbelsäule, und reicht von der
Herzgegend bis zur Kloake hin. Rechte und linke Urniere liegen
parallel, ganz nahe nebeneinander, -nur durch das Gekröse oder
Mesenterium voneinander getrennt, jenes schmale dünne Blatt,
welches den Mitteldarm an der unteren Fläche der Urwirbel-
säule anheftet. Der Ausführgang jeder Urniere, der Urnierengang,
verläuft an der unteren und äußeren
Seite der Drüse nach hinten und
mündet?) in die Kloake , ganz nahe
an der Abgangsstelle der Allantois;
später mündet er in die Allantois
selbst (Fig. 211, S. 400);
Fig. 483. Fig. 484.
Fig. 483. Schweinsembryo, 15 mm lang, 6mal vergrößert, von der Bauchseite.
a Vorderbein, z Hinterbein, b Bauchwand, r Geschlechtsleiste, w Urnierengang,
n Urniere, nt deren innerer Teil. Nach Oscar Schnitze.
Fig. 484. Menschlicher Embryo aus der fünften Woche, 9 mm lang, 10 mal
vergrößert, von der Bauchseite gesehen (die vordere Bauchwand, b, ist entfernt, die
Leibeshöhle, c, geöffnet), d Darmrohr (abgeschnitten), f Stimfortsatz, g Großhirn, m
Mittelhirn, e Nachhirn, h Herz, k erste Kiemenspalte, l Lungenbläschen, n Umiere,
r Geschlechtsleiste, j> Phallus (Geschlechtshöcker), s Schwanz. Nach Kollm ann.
Die Urnie r e oder Primordialniere wurde beim Embryo der
Amnioten früher bald als „ Wolff scher Körper“, bald als „Oken-
scher Körper“ bezeichnet. Sie fungiert überall eine Zeit lang