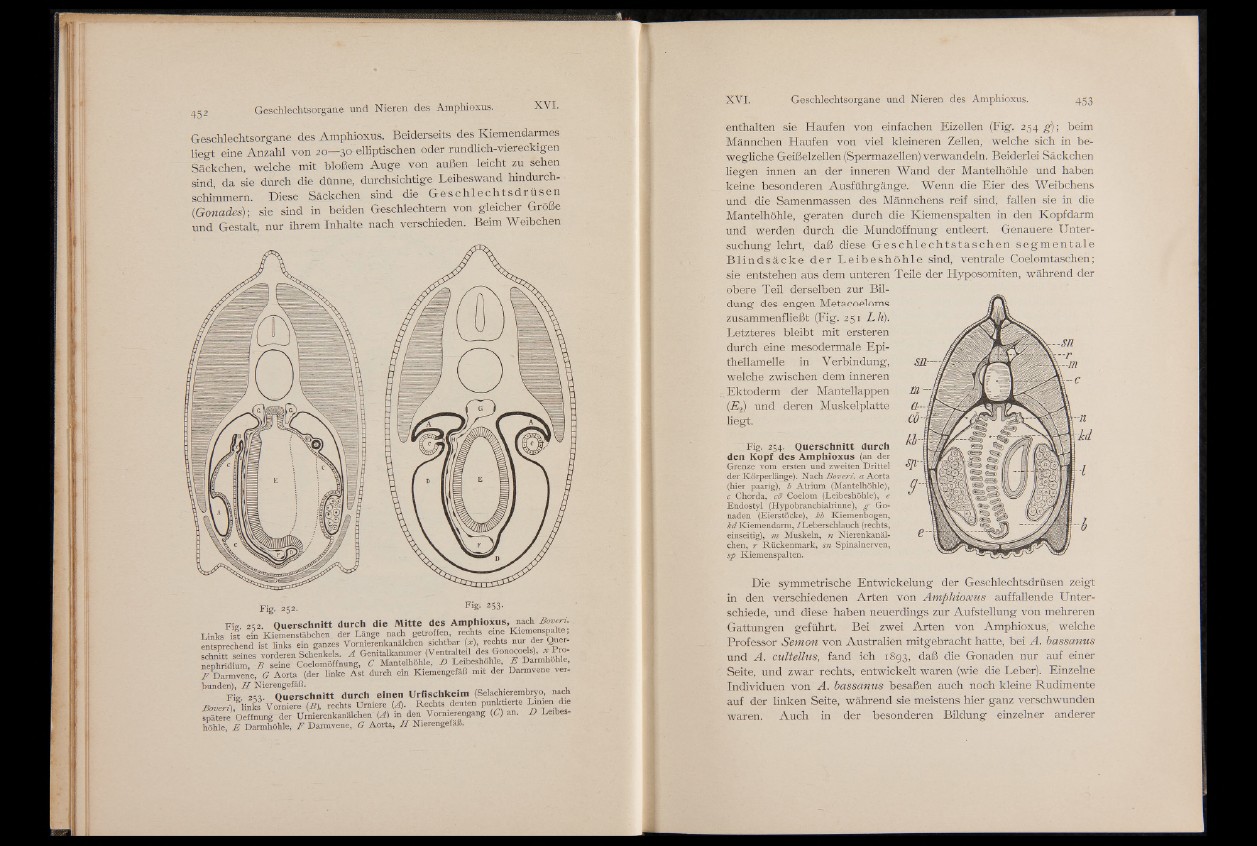
45 2
Geschlechtsorgane des Amphioxus. Beiderseits des Kiemendarmes
liegt eine Anzahl von 20—30 elliptischen oder rundlich-viereckigen
Säckchen, welche mit bloßem Auge von außen leicht zu sehen
sind, da sie durch die dünne, durchsichtige Leibeswand hindurchschimmern.
Diese Säckchen sind die Ge s chl e cht sdrüs en
(Gonades) ; sie sind in beiden Geschlechtern von gleicher Größe
und Gestalt, nur ihrem Inhalte nach verschieden. Beim Weibchen
Fig. 252. Fig. z53-
Fig. 2?2. Querschnitt durch die Mitte des Amphioxus, nach U M
Links iS ein Kiemenstäbchen der Länge nach getroffen, rechts eine Kiemenspalte,
entsprechend ist links ein ganzes Vomierenkanälcben sichtbar (*), rechts nur der Que -
schnitt seines vorderen Schenkels. A Gemtalkammer (Ventralted des Gono^oels), x Pro-
nephridium, B seine Coelomöffnnng, C Mantelhohle, D Leibeshohle, B Darmhohle,
y Dannvene, G Aorta (der linke Ast durch ein Kiemengefäß mit der Darmvene verbunden),
H Nierengefäß. , . , ,
Fig. 2 « . Querschnitt durch einen Urfischkeim (Seladnerembryo, nach
links Vomiere ■ rechts Umiere (A). Redite deuten punktierte Limen die
spätere Oeffnung'der Urnierenkanälchen (A) in den Vornierengang (C) an. D Leibeshöhle,
E Darmhöhle, F Darmvene, G Aorta, H Nierengefaß.
enthalten sie Haufen von einfachen Eizellen (Fig. 254 g); beim
Männchen Haufen von viel kleineren Zellen, welche sich in bewegliche
Geißelzellen (Spermazellen) verwandeln. Beiderlei Säckchen
hegen innen an der inneren Wand der Mantelhöhle uiid haben
keine besonderen Ausführgänge. Wenn die Eier des Weibchens
und die Samenmassen des Männchens reif sind, fallen sie in die
Mantelhöhle, geraten durch die Kiemenspalten in den Kopfdarm
und werden durch die Mundöffnung entleert. Genauere Untersuchung
lehrt, daß diese Ge s chle cht s ta s chen s egmenta le
B l in d s ä c k e der L e ibe shöhle sind, ventrale Coelomtaschen;
sie entstehen aus dem unteren Teile der Hyposomiten, während der
obere Teil derselben zur Bildung
des engen Metacoeloms
zusammenfließt (Fig. 251 Lh).
Letzteres bleibt mit ersteren
durch eine mesodermale Epithellamelle
in Verbindung,
welche zwischen dem inneren
Ektoderm der Mantellappen
(-E2) und deren Muskelplatte
Hegt.
~ Fig. 254. Querschnitt durch
den Kopf des Amphioxus (an der
Grenze vom ersten und zweiten Drittel
der Körperlänge). Nach Boveri. a Aorta
(hier paarig), b Atrium (Mantelhöhle),
c Chorda, cö Coelom (Leibeshöhle), e
Endostyl (Hypobranchialrinne), g Gonaden
(Eierstöcke), kb Kiemenbogen,
kd Kiemendarm, l Leberschlauch (rechts,
einseitig), m Muskeln, # Nierenkanälchen,
r Rückenmark, sn Spinalnerven,
sfi Kiemenspalten.
Die symmetrische Entwickelung der Geschlechtsdrüsen zeigt
in den verschiedenen Arten von Amphioxus auffallende Unterschiede,
und diese haben neuerdings zur Aufstehung von mehreren
Gattungen geführt. Bei zwei Arten von Amphioxus; welche
Professor Semon von Australien mitgebracht hatte, bei A. bassanus
und A. cultellus, fand ich 1893, daß die Gonaden nur auf einer
Seite, und zwar rechts,' entwickelt waren (wie die Leber). Einzelne
Individuen von A. bassanus besaßen auch noch kleine Rudimente
auf der linken Seite, während sie meistens hier ganz verschwunden
waren. Auch in der besonderen Bildung einzelner anderer