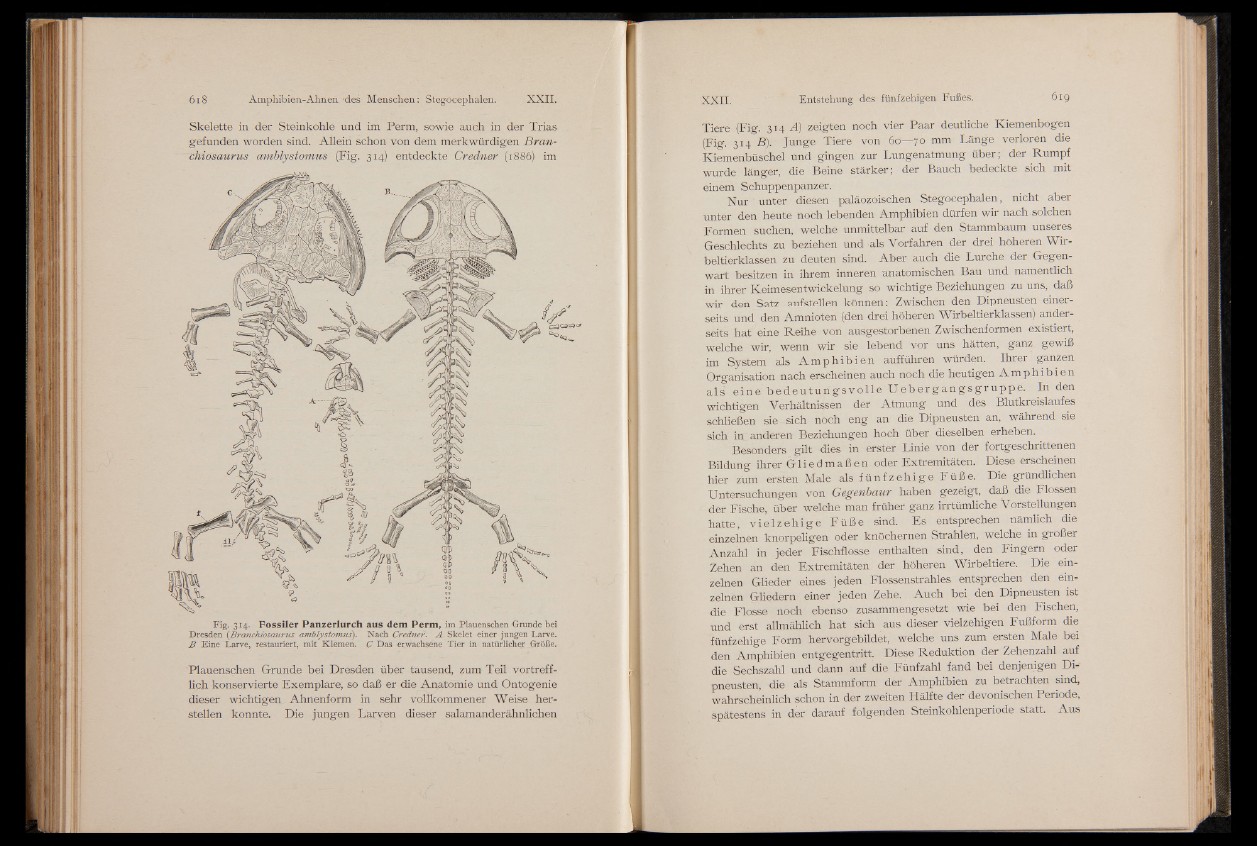
Skelette in der Steinkohle und im Perm, sowie auch in der Trias
gefunden worden sind. Allein schon von dem merkwürdigen Bran-
chiosaurus amblystomus (Fig. 314) entdeckte Credner (1886) im
Fig. 314. Fossiler Panzerlurch aus dem Perm, im Plauenschen Grunde bei
Dresden (Branchiosaurus amblystomus). Nach Credner. A Skelet einer jungen Larve.
B Eine Larve, restauriert, mit Kiemen. C Das erwachsene Tier in natürlicher Größe.
Plauenschen Grunde bei Dresden über tausend, zum Teil vortrefflich
konservierte Exemplare, so daß er die Anatomie und Ontogenie
dieser wichtigem Ahnenform in sehr vollkommener Weise herstellen
konnte. Die jungen Larven dieser salamanderähnlichen
Tiere (Fig. 314 Ä) zeigten noch vier Paar deutliche Kiemenbogen
(Fig. 314 B). Junge Tiere von 60 -70 mm Länge verloren die
Kiemenbüschel und gingen zur Lungenatmung über; der Rumpf
wurde länger, die Beine stärker; der Bauch bedeckte sich mit
einem Schuppenpanzer.
Nur unter diesen paläozoischen Stegocephalen, nicht aber
unter den heute noch lebenden Amphibien dürfen wir nach solchen
Formen suchen, welche unmittelbar auf den Stammbaum unseres
Geschlechts zu beziehen und als Vorfahren der drei höheren Wirbeltierklassen
zu deuten sind. Aber auch die Lurche der Gegenwart
besitzen in ihrem inneren anatomischen Bau und namentlich
in ihrer Keimesentwickelung so wichtige Beziehungen zu uns, daß
wir den Satz aufstellen können: Zwischen den Dipneusten einerseits
und den Amnioten (den drei höheren Wirbeltierklassen) anderseits
hat' eine Reihe von ausgestorbenen Zwischenformen existiert,
welche wir, wenn wir sie lebend vor uns hätten, ganz gewiß
im System als Amphibien aufführen würden. Ihrer ganzen
Organisation nach erscheinen auch noch die heutigen Amphibien
als eine b ed eu tung s vo l l e Ueb e r g an g s g ru p p e . In den
wichtigen Verhältnissen der Atmung und des Blutkreislaufes
schließen sie sich noch eng an die Dipneusten an, während sie
sich irr anderen Beziehungen hoch über dieselben erheben.
Besonders gilt dies in erster Linie von der fortgeschrittenen
Bildung ihrer Gl iedmaßen oder Extremitäten. Diese erscheinen
hier zürn ersten Male als fün f z eh ig e Füße. Die gründlichen
Untersuchungen von Gegenbaur haben gezeigt, daß die Flossen
der Fische, über welche man früher ganz irrtümliche Vorstellungen
hatte, vie l z e l l ig e Füße sind. Es entsprechen nämlich die
einzelnen knorpeligen oder knöchernen Strahlen, welche in großer
Anzahl in jeder Fischflosse enthalten sind, den Fingern oder
Zehen an den Extremitäten der höheren Wirbeltiere. Die einzelnen
Glieder eines jeden Flossenstrahles entsprechen den einzelnen
Gliedern einer jeden Zehe. Auch bei den Dipneusten ist
die Flosse noch ebenso zusammengesetzt wie bei den Fischen,
und erst allmählich hat sich aus dieser vielzelligen Fußform die
fünfzehige Form hervorgebildet, welche uns zum ersten Male bei
den Amphibien entgegentritt. Diese Reduktion der Zehenzahl auf
die Sechszahl und dann auf die Fünfzahl fand bei denjenigen Dipneusten,
die als Stammform der Amphibien zu betrachten sind,
wahrscheinlich schon in der zweiten Hälfte der devonischen Periode,
spätestens in der darauf folgenden Steinkohlenperiode statt. Aus