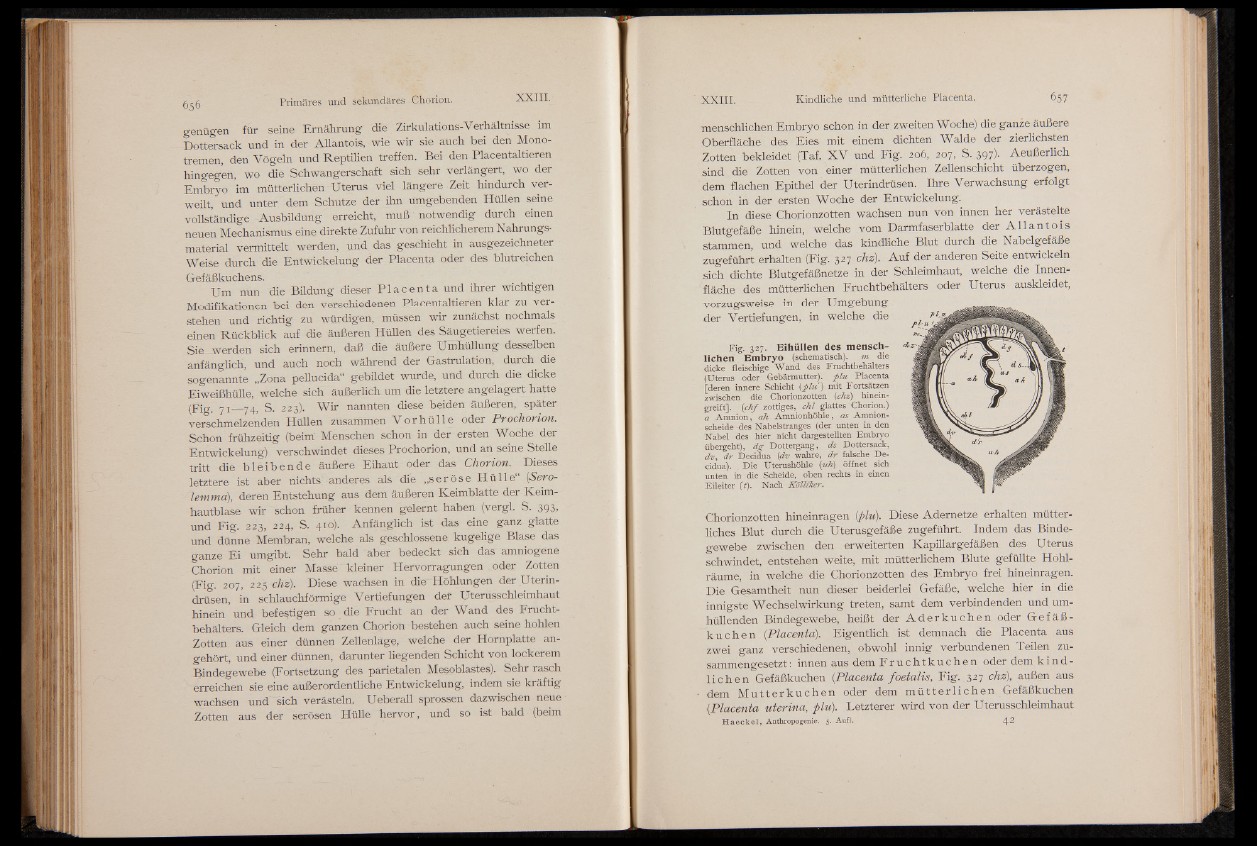
genügen für seine Ernährung' die Zirkulations-Verhältnisse im
Dottersack und in der Allantois, wie wir sie auch bei den Mono-
tremen, den Vögeln und Reptilien treffen. Bei den Placentaltieren
hingegen, wo die Schwangerschaft sich sehr verlängert, wo der
Embryo im mütterlichen Uterus viel längere Zeit hindurch verweilt,
und unter dem Schutze der ihn umgebenden Hüllen seine
vollständige Ausbildung erreicht, muß notwendig durch einen
neuen Mechanismus eine direkte Zufuhr von reichlicherem Nahrungsmaterial
vermittelt werden, und das geschieht in ausgezeichneter
Weise durch die Entwickelung der Placenta oder des blutreichen
Gefäßkuchens.
Um nun die Bildung dieser Pla c enta und ihrer wichtigen
Modifikationen bei den verschiedenen Placentaltieren klar zu verstehen
und richtig zu würdigen, müssen wir zunächst nochmals
einen Rückblick auf die äußeren Hüllen des Säugetiereies werfen.
Sie .werden sich erinnern, daß die äußere Umhüllung desselben
anfänglich, und auch noch während der Gastrulation, durch die
sogenannte „Zona pellucida“ gebildet wurde, und durch die dicke
Eiweißhülle, welche sich äußerlich um die letztere angelagert hatte
(Fig. 71—74, S. 223). Wir nannten diese beiden äußeren, später
verschmelzenden Hüllen zusammen V o r hül le oder Prochorion.
Schon frühzeitig (beim Menschen schon in der ersten Woche der
Entwickelung) verschwindet dieses Prochorion, und an seine Stelle
tritt die ble ibende äußere Eihaut oder das Chorion. Dieses
letztere ist aber nichts anderes als die „seröse Hül le “ (Serolemma),
deren Entstehung aus dem äußeren Keimblatte der Keimhautblase
wir schon früher kennen gelernt haben (vergl. S. 393,
und Fig. 223, 224, S. 410). Anfänglich ist das eine ganz glatte
und dünne Membran, welche als geschlossene kugelige Blase das
ganze Ei umgibt. Sehr bald aber bedeckt sich das amniogene
Chorion mit einer Masse ^kleiner Hervorragungen oder Zotten
(Fig. 207, 225 chz). Diese wachsen in die Höhlungen der Uterindrüsen,
in schlauchförmige Vertiefungen def Uterusschleimhaut
'hinein und befestigen so die Frucht an der Wand des Fruchtbehälters.
Gleich dem ganzen Chorion bestehen auch seine hohlen
Zotten aus einer dünnen Zellenlage, welche der Hornplatte angehört,
und einer dünnen, darunter hegenden Schicht von lockerem
Bindegewebe (Fortsetzung des parietalen Mesoblastes). Sehr rasch
erreichen sie eine außerordentliche Entwickelung, indem sie kräftig
wachsen und Aich verästeln. Ueberall sprossen dazwischen neue
Zotten aus der serösen Hülle hervor, und so ist bald (beim
menschlichen Embryo schon in der zweiten Woche) die ganze äußere
Oberfläche des Eies mit einem dichten Walde der zierlichsten
Zotten bekleidet (Taf, X V und Fig. 206, 207, S. 397). Aeußerlich
sind die Zotten von einer mütterlichen Zellenschicht überzogen,
dem flachen Epithel der Uterindrüsen. Ihre Verwachsung erfolgt
schon in der ersten Woche der Entwickelung.
In diese Chorionzotten wachsen nun von innen her verästelte
Blutgefäße hinein, welche vom Darmfaserblatte der Al lanto i s
stammen, und welche das kindliche Blut durch die Nabelgefäße
zugeführt erhalten (Fig. 327 chz). Auf der anderen Seite entwickeln
sich dichte Blutgefäßnetze in der Schleimhaut, welche die Innenfläche
des mütterlichen Fruchtbehälters oder Uterus auskleidet,
vorzugsweise in der Umgebung
der Vertiefungen, in welche die
Fig. 327. Eihüllen des menschlichen
Embryo (schematisch), m die
dicke fleischige "Wand des Fruchtbehälters
(Uterus oder Gebärmutter), p lu Placenta
[deren innere Schicht (p lu ) mit Fortsätzen
zwischen die Chorionzotten (chz) hineingreift].
(ch f zottiges, ch l glattes Chorion.)
a Amnion, ah Amnionhöhle, cts Amnionscheide
des Nabelstranges (der unten in den
Nabel des hier nicht dargestellten Embryo
übergeht), dg Dottergang, ds Dottersack,
d v, dr Deddua (du wahre, d r falsche De-
cidua). , Die Uterushöhle (uh) öffnet sich
unten in die . Scheide, oben rechts in einen
Eüeiter (t). Nach K ö lliker.
Chorionzotten hineinragen (plu). Diese Adernetze erhalten mütterliches
Blut durch die Uterusgefäße zugeführt. Indem das Bindegewebe
zwischen den erweiterten Kapillargefäßen des Uterus
schwindet, entstehen weite, mit mütterlichem Blute gefüllte Höhlräume,
in welche die Chorionzotten des Embryo frei hineinragen.
Die Gesamtheit nun dieser beiderlei Gefäße, welche hier in die
innigste Wechselwirkung treten, samt dem verbindenden und umhüllenden
Bindegewebe, heißt der Ad e r k u c h e n oder Gefäß-
kuchen (Placenta). Eigentlich ist demnach die Placenta aus
zwei ganz verschiedenen, obwohl innig verbundenen Teilen zusammengesetzt:
innen aus dem Fru chtku chen oder dem k in d l
i chen Gefäßkuchen (.Placenta foetalis, Fig. 327 chz), außen aus
dem Mut te rkuchen oder dem müt te r l ichen Gefäßkuchen
(Placenta uterina, plu). Letzterer wird von der Uterusschleimhaut
H a e c k e l , Anthropogenie. 5. Aufl. \ 2