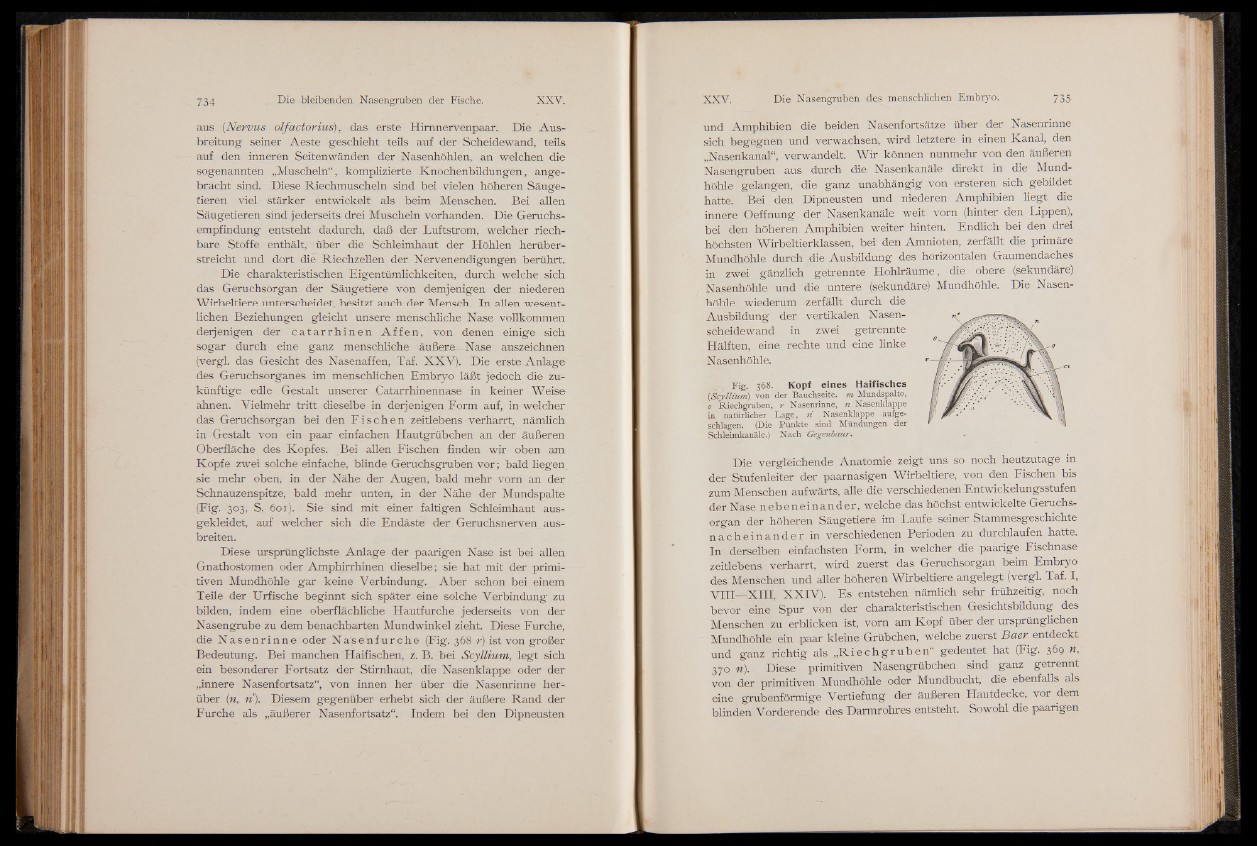
aus (Nervus olfactorius), das erste Hirnnervenpaar. Die Ausbreitung
seiner Aeste geschieht teils auf der Scheidewand, teils
auf den inneren Seitenwänden der Nasenhöhlen, an welchen die
sogenannten „Muscheln“ , komplizierte Knochenbildungen, angebracht
sind. Diese Riechmuscheln sind bei vielen höheren Säugetieren
viel stärker entwickelt als beim Menschen. Bei allen
Säugetieren sind jederseits drei Muscheln vorhanden. Die Geruchsempfindung
entsteht dadurch, daß der Luftstrom, welcher riechbare
Stoffe enthält, über die Schleimhaut der Höhlen herüberstreicht
und dort die Riechzellen der Nervenendigungen berührt.
Die charakteristischen Eigentümlichkeiten, durch welche sich
das Geruchsorgan der Säugetiere von demjenigen der niederen
Wirbeltiere unterscheidet, besitzt auch der Mensch. In allen wesentlichen
Beziehungen gleicht unsere menschliche Nase vollkommen
derjenigen der catar rhinen Af fen, von denen einige sich
sogar durch eine ganz menschliche äußere Nase auszeichnen
(vergl. das Gesicht des Nasenaffen, Taf. XXV). Die erste Anlage
des Geruchsorganes im menschlichen Embryo läßt jedoch die zukünftige
edle Gestalt unserer Catarrhinennase in keiner Weise
ahnen. Vielmehr tritt dieselbe in derjenigen Form auf, in welcher
das Geruchsorgan bei den Fi schen zeitlebens verharrt, nämlich
in Gestalt von ein paar einfachen Hautgrübehen an der äußeren
Oberfläche des Kopfes. Bei allen Fischen finden wir oben am
Kopfe zwei solche einfache, blinde Geruchsgruben vor; bald liegen,
sie mehr oben, in der Nähe der Augen, bald mehr vorn an der
Schnauzenspitze, bald mehr unten, in der Nähe der Mundspalte
(Fig. 303, S. 60 r). Sie sind mit einer faltigen Schleimhaut ausgekleidet,
auf welcher sich die Endäste der Geruchsnerven ausbreiten.
Diese ursprünglichste Anlage der paarigen Nase ist bei allen
Gnathostomen oder Amphirrhinen dieselbe; sie hat mit der primitiven
Mundhöhle gar keine Verbindung. Aber schon bei einem
Teile der Urfische beginnt sich später eine solche Verbindung zu
bilden, indem eine oberflächliche Hautfurche jederseits von der
Nasengrube zu dem benachbarten Mundwinkel zieht. Diese Furche,
die Nasenr inne oder Na'senfurche (Fig. 368 r) ist von großer
Bedeutung. Bei manchen Haifischen, z. B. bei Scyllium, legt sich
ein besonderer Fortsatz der Stirnhaut, die Nasenklappe oder der
„innere Nasenfortsatz“, von innen her über die Nasenrinne herüber
(n, n). Diesem gegenüber erhebt sich der äußere Rand der
Furche als „äußerer Nasenfortsatz“. Indem bei den Dipneusten
und Amphibien die beiden Nasenfortsätze über der Nasenrinne
sich begegnen und verwachsen, wird letztere in einen Kanal, den
„Nasenkanal“, verwandelt. Wir können nunmehr von den äußeren
Nasengruben aus durch die Nasenkanäle direkt in die Mundhöhle
gelangen, die ganz unabhängig von ersteren sich gebildet
hatte. Bei den Dipneusten und niederen Amphibien liegt die
innere Oeffnung der Nasenkanäle weit vorn (hinter den Lippen),
bei den höheren Amphibien weiter hinten. Endlich bei den drei
höchsten Wirbeltierklassen, bei den Amnioten, zerfällt die primäre
Mundhöhle durch die Ausbildung des horizontalen Gaumendaches
in zwei gänzlich getrennte Hohlräume, die. obere (sekundäre)
Nasenhöhle und die untere (sekundäre) Mundhöhle. Die Nasenhöhle
wiederum zerfällt durch die
Ausbildung der vertikalen Nasenscheidewand
in zwei getrennte
Hälften, eine rechte und eine linke
Nasenhöhle.
I Fig. 368. Kopf eines Haifisches
(,Scyllium.) von der Bauchseite, m Mundspalte,
6 Riechgruben, r Nasenrinne, n NasenHappe
in natürlicher Lage, n Nasenklappe aufgeschlagen.
(Die Punkte sind Mündungen der
Schlehnkanäle.) Nach Gegeribaur.
Die vergleichende Anatomie zeigt uns so noch heutzutage in
der Stufenleiter der paarnasigen Wirbeltiere, von den Fischen bis
zum Menschen aufwärts, alle die verschiedenen Entwickelungsstufen
der Nase nebeneinander , welche das höchst entwickelte Geruchsorgan
der höheren Säugetiere im Laufe seiner Stammesgeschichte
nache inande r in verschiedenen Perioden zu durchlaufen hatte.
In derselben einfachsten Form, in welcher die paarige Fischnase
zeitlebens verharrt, wird zuerst das Geruchsorgan beim Embryo
des Menschen und aller höheren Wirbeltiere angelegt (vergl. Taf. I,
VIII—XIII, XXIV). Es entstehen nämlich sehr frühzeitig, noch
bevor eine Spur von der charakteristischen Gesichtsbildung des
Menschen zu erblicken ist, vorn am Kopf über der ursprünglichen
Mundhöhle ein paar kleine Grübchen, welche zuerst Baer entdeckt
und ganz richtig als „Rie chg ruben gedeutet hat (Fig. 369
370 n). Diese primitiven Nasengrübchen sind ganz getrennt
von der primitiven Mundhöhle oder Mundbucht, die ebenfalls als
eine grubenförmige Vertiefung der äußeren Hautdecke, vor dem
blinden Vorderende des Darmrohres entsteht. Sowohl die paarigen