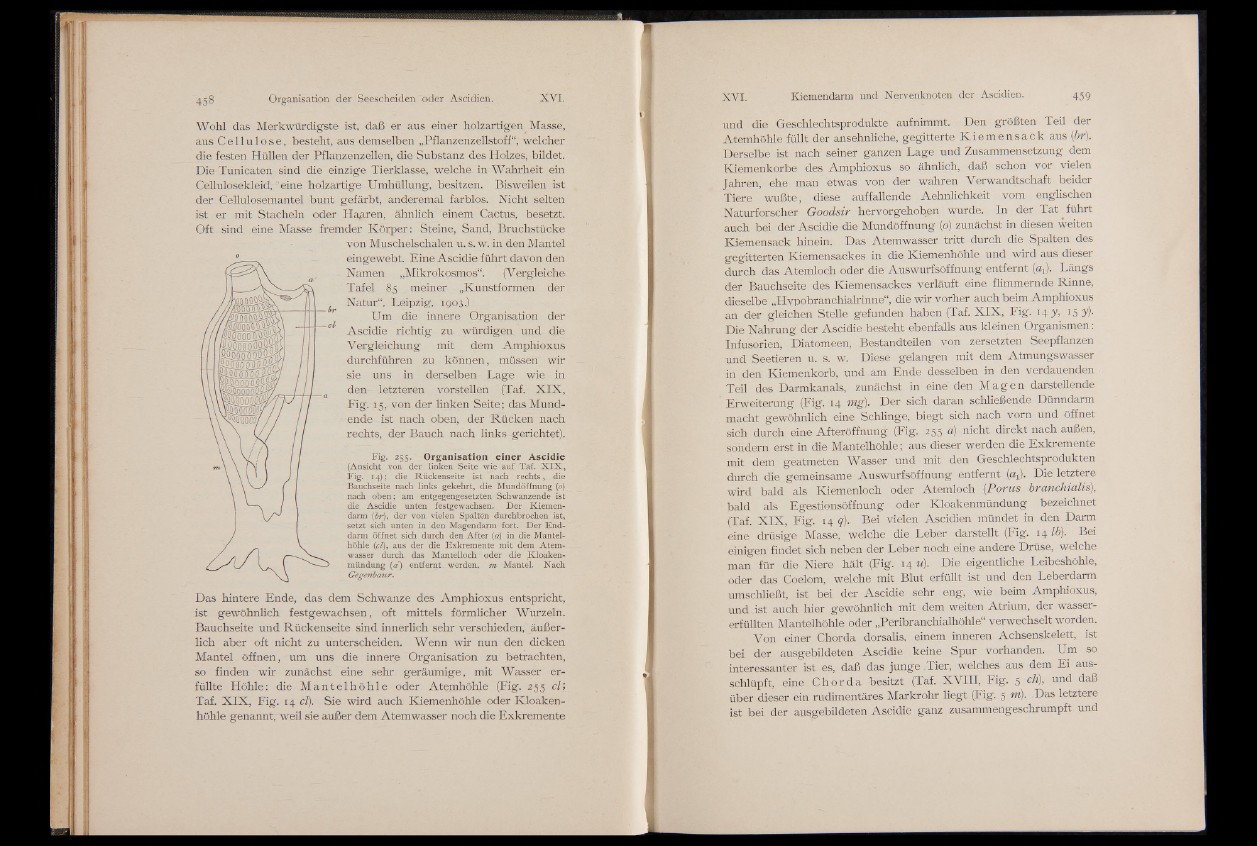
Wohl das Merkwürdigste ist, daß er aus einer holzartigen Masse,
aus C e 11 u 1 o,s e , besteht, aus demselben „Pflanzenzellstoff“, welcher
die festen Hüllen der Pflanzenzellen, die Substanz des Holzes, bildet.
Die Tunicaten sind die einzige Tierklasse, welche in Wahrheit ein
CellulosekleidJ f eine holzartige Umhüllung, besitzen. Bisweilen ist
der Cellulosemantel bunt gefärbt, anderemal farblos. Nicht selten
ist er mit Stacheln oder Haaren, ähnlich einem Cactus, besetzt.
Oft sind eine Masse fremder Körper: Steine, Sand, Bruchstücke
von Muschelschalen u. s. w. in den Mantel
eingewebt. Eine Ascidie führt davon den
Namen „Mikrokosmos“. (Vergleiche
Tafel 85 meiner „Kunstförmen der
Natur“, Leipzig, 1903.)
Um die innere Organisation der
Ascidie richtig zu. würdigen und cjie
Vergleichung mit den* Amphioxus
durchführen zu können, müssen wir
sie uns in derselben Lage wie in
den- letzteren vorstellen (Taf-, XIX,
Fig. 15, von der linken Seite; das Mundende
ist nach oben, der Rücken nach
reehts, der Bauch nach links gerichtet).
. Fig. 255. Organisation einer Ascidie
(Ansicht von der linken Seite wie auf Täf. X IX ,
Fig. 14); die Rückenseite ist nach rechts, die
Bauchseite nach links gekehrt, die Mundöffnung (o)
nach oben; am entgegengesetzten Schwanzende ist
die Ascidie unten festgewachsen. Der Kiemendarm
(br), der von vielen Spälten durchbrochen ist,
setzt sich unten in den Magendarm fort. Der Enddarm
öffnet sich durch den After (a) in die Mantelhöhle
(cl), aus der die Exkremente mit dem Atemwasser
durch das Mantelloch oder die Kloakenmündung
(a ) entfernt werden, m Mantel. Nach
Gegeribaur.
Das hintere Ende, das dem Schwänze des Amphioxus entspricht,
ist gewöhnlich festgewachsen, oft mittels förmlicher Wurzeln.
Bauchseite und Rückenseite sind innerlich sehr verschieden,' äußerlich
aber oft nicht zu unterscheiden. Wenn wir nun den dicken
Mantel öffnen, um uns die, innere Organisation zu betrachten,
so finden wir zunächst eine sehr geräumige, mit Wasser erfüllte
Höhle: die Mante lhöhl e oder Atemhöhle (Fig. 255 cl',
Taf. XIX, Fig. 14 et). Sie wird auch Kiemenhöhle oder Kloakenhöhle
genanntpweil sie außer dem Atemwasser noch die Exkremente
und die Geschlechtsprodukte auf nimmt. Den größten Teil der
Atemhöhle füllt der ansehnliche, gegitterte Ki eme ns a c k aus (br).
Derselbe ist nach seiner ganzen Lage und Zusammensetzung dem
Kiemenkorbe des Amphioxus so ähnlich, duß schon vor vielen
Jahren, ehe man etwas von der wahren Verwandtschaft beider
Tiere wußte, diese auffallende Aehnlichkeit vom englischen
Naturforscher Goodsir hervorgehoben wurde. In der Tat ^ fuhrt
auch bei der Ascidie die Mundöffnung (0) zunächst in diesen weiten
Kiemensack hinein. Das Atemwasser tritt durch die Spalten des
gegitterten Kiemensackes in die Kiemenhöhle und wird aus dieser
durch das Atemloch oder die Auswurfsöffnung entfernt (a*). Längs
der Bauchseite des Kiemensackes verläuft eine flimmernde Rinne,
dieselbe „Hypobranchialrinne“, die wir vorher auch beim Amphioxus
an der gleichen Stelle gefunden haben (Taf. XIX, Fig. 14 y, 15 y)-
Die Nahrung der Ascidie besteht ebenfalls aus kleinen Organismen:
Infusorien, Diatomeen, Bestandteilen von zersetzten Seepflanzen
und Seetieren u. s. w. Diese gelangen mit dem Atmungswasser
inj den Kiemenkorb, und am Ende desselben in den verdauenden •
Teil des Darmkanals, zunächst in eine den Ma gen darstellende
Erweiterung (Fig. 14 Der sich daran schließende Dünndarm
macht gewöhnlich eine Schlinge, biegt sich nach vorn und öffnet
sich durch eine Afteröffnung (Fig. 255 a) nicht direkt nach außen,
sondern erst in die Mantelhöhle; aus dieser werden die Exkremente
mit dem geatmeten Wasser und mit den Geschlechtsprodukten
durch die gemeinsame Auswurfsöffnung entfernt (<%). Die letztere
wird bald als Kiemenloch oder Atemloch (P oyus bvcitichictlis).
bald als Egestionsöffnung oder Kloakenmündung bezeichnet
(Taf. XIX, Fig. 14 q). Bei vielen Ascidien mündet in den Darm
eine drüsige Masse, welche die Leber darstellt (Fig. 14/6). Bei
einigen findet sich neben der Leber noch eine andere Drüse, welche
man für die Niere hält (Fig. 14 u). Die eigentliche Leibeshöhle,
oder das Coelom, welche mit Blut erfüllt ist und den Leberdarm
umschließt, ist bei der Ascidie sehr eng, wie beim Amphioxus,
und is t auch hier gewöhnlich mit dem weiten Atrium, der wasser-
erfüllten Mantelhöhle oder „Peribranchialhöhle“ verwechselt worden.
Von einer Chorda dorsalis, einem inneren Achsenskelett, ist
bei der ausgebildeten Ascidie keine Spur vorhanden. Um so
interessanter ist es, daß das junge .Tier, welches aus dem Ei ausschlüpft,
eine Chorda besitzt (Taf. XVIII, Fig. 5 ch), und daß
über dieser ein rudimentäres Markrohr hegt (Fig. 5 m). Das letztere
ist bei der ansgebildeten Ascidie ganz zusammengeschrumpft und