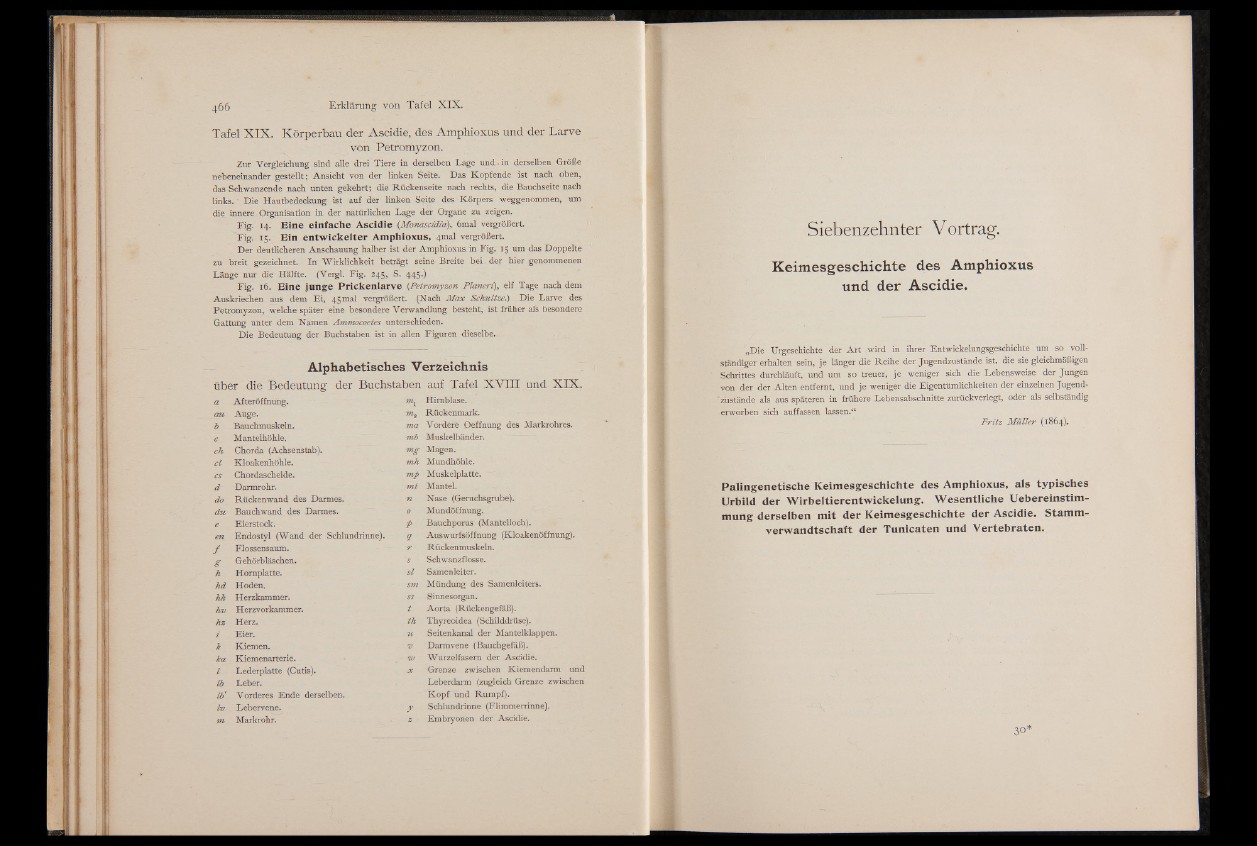
466 Erklärung yon Tafel XIX.
Tafel XIX. Körperbau der Ascidie, des Amphioxus und der Larve
von Petromyzon.
Zur Vergleichung sind alle drei Tiere in derselben Lage und.in derselben Größe
nebeneinander gestellt; Ansicht von der linken Seite. Das Kopfende ist nach oben,
das Schwanzende nach unten gekehrt; die Rückenseite nach rechts, die Bauchseite nach
links. Die Hautbedeckung ist auf der linken Seite des Körpers weggenommen, um
die innere Organisation in der natürlichen Lage der Organe zu zeigen.
Fig. 14. Bine einfache Ascidie (Monascidia), 6mal vergrößert.
Fig. 15. Ein entwickelter Amphioxus, 4mal vergrößert.
Der deutlicheren Anschauung halber ist der Amphioxus. in Fig. 15 um das Doppelte
zu breit gezeichnet. In Wirklichkeit beträgt seine Breite bei der hier genommenen
Länge nur die Hälfte. (Vergl. Fig. 245, S. 445.)
Fig. 16. Eine junge Prickenlarve (Petromyzon P la n en j, elf Tage nach dem
Auskriechen aus dem Ei, 45mal vergrößert. (Nach M ax Schnitze.) Die Larve des
Petromyzon, welche später eine besondere Verwandlung besteht, ist früher als besondere
Gattung unter dem Namen Ammocoetes unterschieden.
Die Bedeutung der Buchstaben ist in allen Figuren dieselbe. .
Alphabetisches Verzeichnis
über die Bedeutung der Buchstaben auf Tafel XVIII und XIX.
a Afteröffnung. my Himblase.
au Auge. m2 Rückenmark.
b Bauchmuskeln. ma Vordere Oeffnung des Markrohres.
c Mantelhöhle. mb Muskelbänder.
ch Chorda (Achsenstab). mg Magen.
c l Kloakenhöhle. mh Mundhöhle.
cs Chordascheide. mp Muskelplatte.
d Darmrohr. m t Mantel.
do Rückenwand des Darmes. n Nase (Geruchsgrube).
du Bauchwand des Darmes. 0 Mundöffnung.
e Eierstock. P Bauchporus (Mantelloch),
en Endostyl (Wand der Schlundrinne). q Auswurfsöffnung (Kloakenöffnung).
f Flossensaum. r Rückenmuskeln.
g Gehörbläschen. ~s Schwanzflosse.
h Homplatte. s l Samenleiter.
hd Hoden. sm Mündung des Samenleiters.
hk Herzkammer. SS Sinnesorgan.
hv Herzvorkammer. t Aorta (Rückengefäß).
hz Herz. th Thyreoidea (Schilddrüse).
i Eier. u Seitenkanal der Mantelklappen.
k Kiemen. 1) Darmvene (Bauchgefäß).
ka Kiemenarterie. - w Wurzelfasern der Asöidie.
l.
Lederplatte (Cutis).
U,
Leber.
lb '
Vorderes Ende derselben.
X Grenze zwischen Kiemendarm und
Leberdarm (zugleich Grenze zwischen
Kopf und Rumpf).
Iv Lebervene. y Schlundrinne (Fhmmerrinne).
m Markrohr. z Embryonen der Ascidie.
Siebenzehnter Vortrag.
Keimesgeschichte des Amphioxus
und der Ascidie.
„Die Urgeschichte der Art wird in ihrer Entwickelungsgeschichte um so vollständiger
erhalten sein, je länger die Reihe der Jugendzustände ist, die sie gleichmäßigen
Schrittes durchläuft, und um so treuer, je weniger sich die Lebensweise der Jungen
von der der Alten entfernt, und je weniger die Eigentümlichkeiten der einzelnen Jugend-
' zustände als aus späteren in frühere Lebensabschnitte zurückverlegt, oder als selbständig
erworben sich auffassen lassen.“
F r itz M ü ller (1864).
Palingenetische Keimesgeschichte des Amphioxus, als typisches
Urbild der Wirbeltierentwickelung. Wesentliche Uebereinstim-
mung derselben mit der Keimesgeschichte der Ascidie. Stammverwandtschaft
der Tunicaten und Vertebraten.
30*