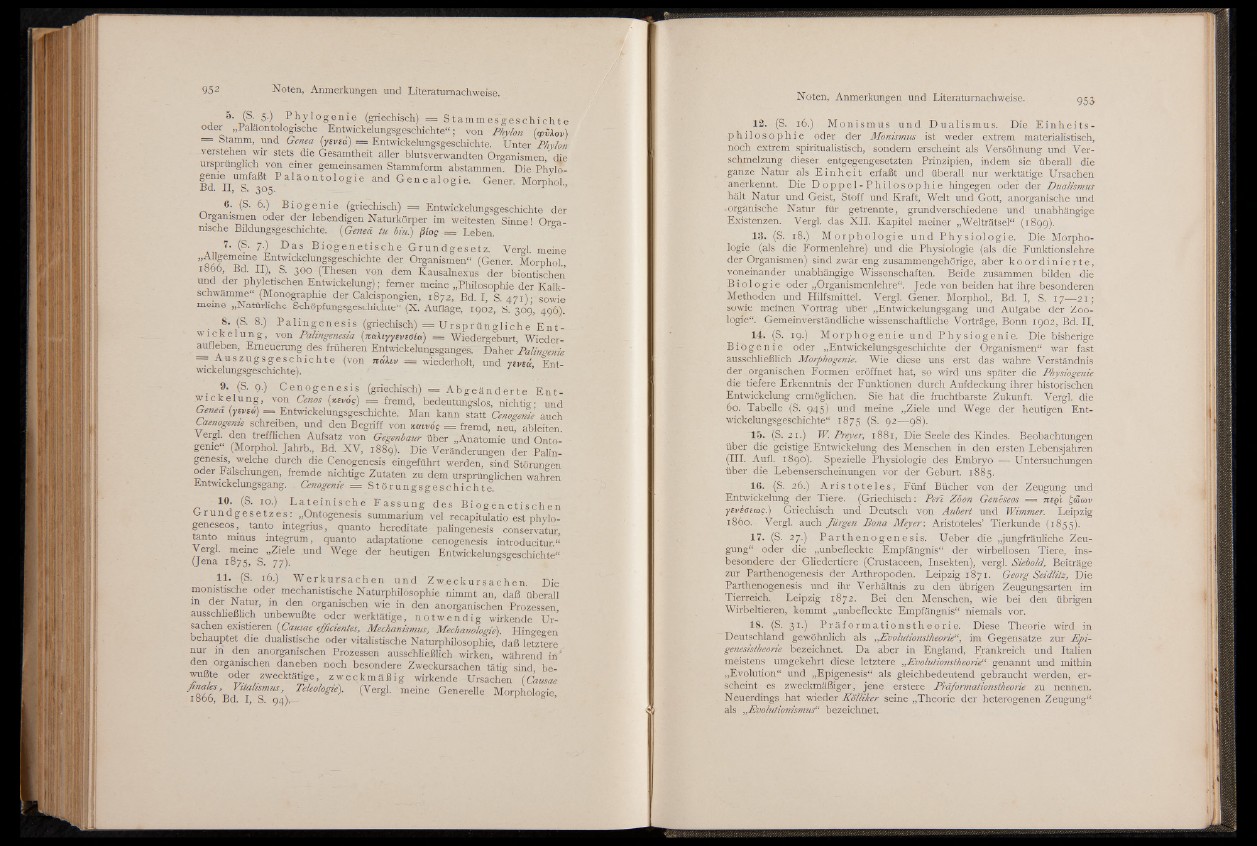
5 . (S. 5.) P h y l o g e n i e (griechisch) = S t a m m e s g e s c h i c h t e
oder „Paläontologische Entwickelungsgeschichte“ ; v o n Pkylon (<pvXov)
Stamm, u nd Genea (ysvea) = Entwickelungsgeschichte. Unter Phylon
verstehen wir stets die Gesamtheit aller blutsverwandten Organismen die
ursprünglich von einer gemeinsamen Stammform abstammen. D ie P h y lo -
geme umfaßt P a l ä o n t o l o g i e and G e n e a l o g i e . Gener. Morphol.,
Ed. I I , S. 305. ' r *
6. (S. 6.) B i ö g e n i e (griechisch) = Entwickelungsgeschichte der
Organismen oder der lebendigen Naturkörper im weitesten S in n e ! O rga nische
Bildungsgeschichte. (Gened tu bin) §iog = Leben.
7. (S. 7.) D a s B i o g e n e t i s c h e G r u n d g e s e t z . Vergl. meine
» d H Entwickelungsgeschichte der Organismen“ (Gener. Morphol.
1 j 6, Bd. II ) , S. 3 0 0 (Thesen v o n dem K a u sa ln e xu s der biontischen
u nd der phyletischen En tw ickelun g); ferner meine „Philosophie der K a lk -
schwämme“ (Mo no grap h ie der Calcispongien, 1872, Bd. I, S, 471 ) - sowie
meme „Natürliche Schöpfungsgeschichte“ (X . Auflage, 1902, S. 309, 496).
8. (S. 8.) P a l i n g e n e s i s (griechisch) = U r s p r ü n g l i c h e E n t w
i c k e l u n g , v o n Palingenesia (nahyysvssia) = = Wiedergeburt W ie d e r aufleben,
E rne u erun g des früheren E n tw ic k lu n g sga n ge s.- D a h e r ’Palmgenie
A u - s z u g s g e s c h i e h t e (von nahv — wiederholt, u nd ysvsd E n t -
wick elungsgeschichte). i
9 . (S. 9.) C e n o g e n e s i s (griechisch) = A b g e ä n d e r t e E n t w
i c k e l u n g , v o n Cenos (xsvoe) = fremd, bedeutungslos, nichtig- u nd
Genea (ysvsc) = Entwickelungsgeschichte; M a n kann statt Cenogeni’e auch'
Caenogenie schreiben, u n d den Begriff von xenväg = fremd, neu, abloiten.
Vergl. den trefflichen Aufsatz von Gegenbaur über „Anatomie u nd Onto-
gerne (Morphol. Jahrb., Bd. X V , 1889). D ie Veränderungen der Palin-
genesis, welche durch die Cenogenesis eingeführt werden, sind Störungen
oder Fälschungen, fremde nichtige Zutaten zu dem ursprünglichen wahren
Entwickelungsgang. . Cenogenie = S t ö r u n g s g e s c h i c h t e .
10. (S. io .) L a t e i n i s x h e F a s s u n g d e s B i o g e n e t i s c h e n
G r u n d g e s e t z e s - : „Ontogenesis summarium vel recapitulatio est p hy lo-
geneseos, tanto integrius, quanto hereditate palingenesis conservatur
tanto minus integrum, quanto adaptatione cenogenesis introducitur.“
Vergl. meme „Ziele u nd W e ge der heutigen Entwickelungsgeschichte“
(Jena 1875, S. 77). .. ° 5 . '
11. (S. 16.) W e r k u r s a c h e n u n d Z w j e c k u r s a c h e n . D ie
monistische oder mechanistische Naturphilosophie nimmt an, daß überall
m d ? v ^ 1at" r> in den organischen, wie in den anorganischen Prozessen
ausschließlich unbewußte oder werktätige, n o t w e n d i g wirkende U r sachen
existieren (Causae efficientes, Mechanismus, Mechanologie). H ingege n
behauptet die dualistische oder vitälistische Naturphilosophie, daß letztere
n u r m den anorganischen Prozessen ausschließlich wirken, während i i /
den organischen daneben n och besondere Zweckursachen tätig sind bewußte
oder zwecktätige, z w e c k m ä ß i g wirkende Ursach e n (Causae
Teleologie). (Vergl. meine Generelle Mo rp h olo gie
1800, Bd. I, S. 94),—
12. (S. 16.) M o n i s m u s u n d D u a l i s m u s . Di e E i n h e i t s -
p h i l o s o p h i e oder der Monismus ist weder extrem materialistisch,
noch extrem spiritualistisch, sondern erscheint als Ve rsö h n u n g u nd V e r schmelzung
dieser, entgegengesetzten Prinzipien, indem sie überall die
ganze N a tu r als E i n h e i t erfaßt u nd überall n ur werktätige Ursachen
anërkennt. D ie D o p p e l - P h i l o s . o p h i e hingegen oder der Dualismus
hält N a tu r u nd Geist, Stoff u nd Kraft, We lt u nd Gott, anorganische u nd
.organische N a tu r für getrennte, grundverschiedene u nd unabhängige
Existenzen. Vergl. das X I I . K ap ite l meiner „Welträtsel“ (1899).
1 3 . (S. 18.) M o r p h o l o g i e u n d P h y s i o l o g i e . D ie M o rp h o logie.
(als die Formenlehre) u nd die Phy siologie (als die .Funktionslehre
der Organismen) sind zwar eng zusammengehörige, aber k o o r d i n i e r t e ,
voneinander unabhängige Wissenschaften. Beide zusammen bilden die
B i o l o g i e oder „Organismenlehre“. Jede von beiden hat ihre besonderen
M e th od e n u nd Hilfsmittel. Vergl. Gener. Morphol., Bd. I, S. 17— 21 ;
sowie meinen Vo rtrag über „Entwickelungsgang u nd Aufgabe der Z o o logie“.
Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge, B o n n 1902, Bd. I I .
1 4 . (S. 19.) M o r p h o g e n i e u n d P h y s l o g e n i e . D ie bisherige
B i ö g e n i e oder „Entwickelungsgeschichte der Organismen“ war fast
ausschließlich Morphogenie. W ie diese uns erst das wahre Verständnis
der organischen Form e n eröffnet hat, so wird uns später die Physiogenie
die tiefere Erkenntnis der Funktionen durch Aufdecku ng ihrer historischen
Entwickelung ermöglichen. Sie hat die fruchtbarste Zukunft. Vergl. die
60. Tabelle (S. 945) u nd meine „Ziele und, W e ge der heutigen E n t -
wickelungsgeschichte“ 1875 (S. 92— 98).
1 5 . (S. 21.) W. Preyer; 1881, D ie Seele'des Kindes. Beobachtungen
über die geistige Entwickelung des M e nsch en in den ersten Lebensjahren
( I I I . Aufl. 1890). Spezielle Physiologie d e s . Em b ry o — Untersuchungen
über die Lebenserscheinungen vor der Geburt. 1885.
1 6 . (S. 26.) A r i s t o t e l e s , F ü n f Bücher von der Z eu gu ng u nd
Entwickelung der Tiere. (Griechisch: Pen Zoon Geneseos — tcsqï fmcov
ysvEGEcog.) Griechisch u nd D eutsch v o n Aubert u n d Wimmer. Leipzig
1860. Vergl. auch Jürgen Bona Meyer: Aristoteles’ T ierkunde (1855).
1 7 . (S. 27.) P a r t h e n ö g e n e s i s . U eb e r die „jungfräuliche Z e u gu
ng“ oder die „unbefleckte Em p fän gn is“ der wirbellosen Tiere, insbesondere
der Gliedertiere (Crustaceen, Insekten), vergl. Siebold, Beiträge
zur Parthenögenesis der Arthropoden. Le ip z ig 1871. Georg Seidlitz, D ie
Parthenögenesis u nd ih r Verhältnis zu den übrigen Zeugungsarten im
Tierreich. L e ip z ig 1872. B e i den Menschen, wie bei den übrigen
Wirbeltieren, kommt „unbefleckte Empfän gn is“ niemals vor.
1 8 . (S. 31.) P r ä f o rm a t i o r i ; s t h e o r i e . D iese The orie wird in
Deutschland gewöhnlich als „E v o lu tion sth eo rieim Gegensätze zur E p i-
genesistheorie bezeichnet. D a aber in England, Frankreich u nd Italien
meistens umgekehrt diese letztere „Evolutionstheorie“ genannt u nd mithin
„Evolut io n “ u nd „Epigenesis“ als gleichbedeutend gebraucht werden, erscheint
es zweckmäßiger, jene erstere Präformationstheorie zu nennen.
Neuerdings hat wieder Kölliker seine „Theorie der heterogenen Z eu gu ng“
als „.Evolutionismus“ bezeichnet.