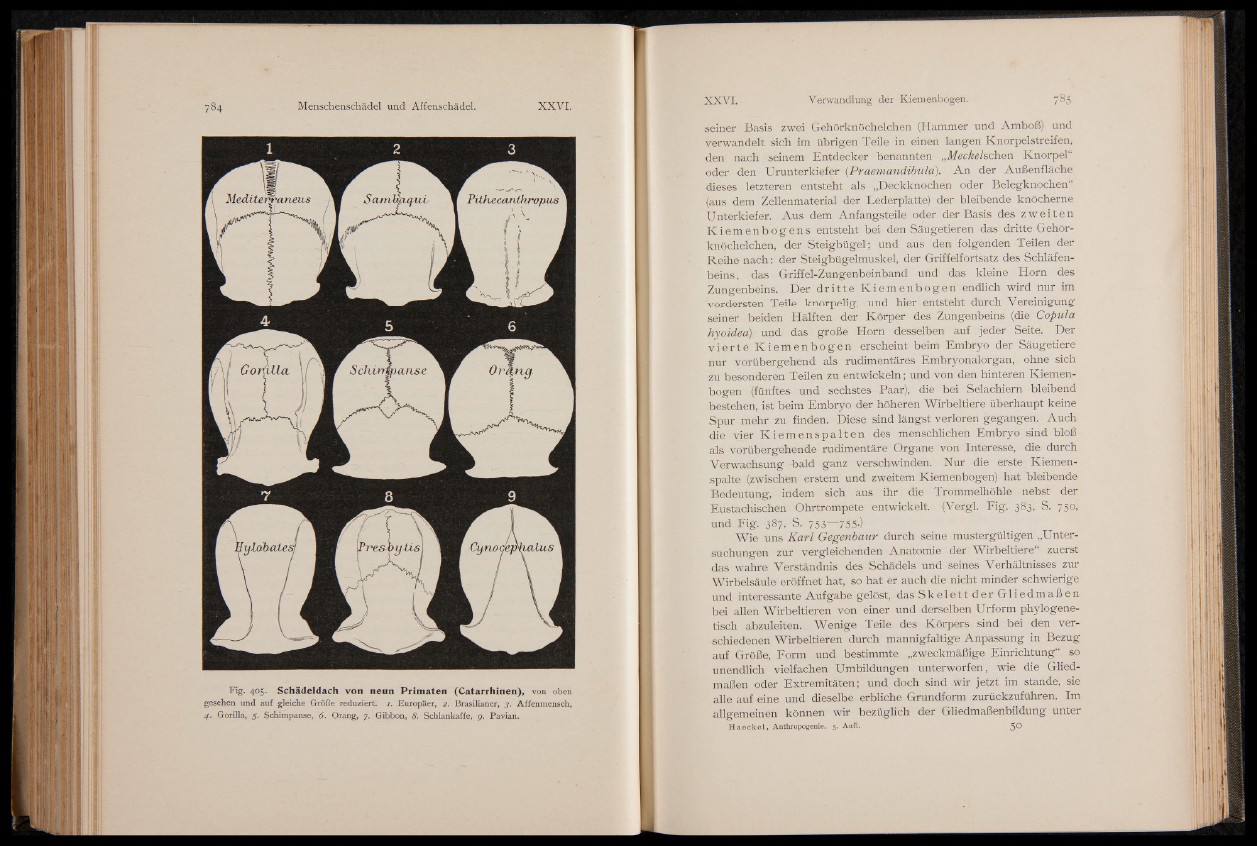
Fig. 405. Schädeldach von neun Primaten (Catarrhinen), von oben
gesehen und auf gleiche Größe reduziert. 1. Europäer, 2. Brasilianer, 3. Affenmensch,
4 . Gorilla, 5. Schimpanse, 6. Orang, 7. Gibbon, 8. Schlankaffe, g. Pavian.
seiner Basis zwei Gehörknöchelchen (Hammer und Amboß) und
verwandelt sich im übrigen Teile in einen langen Knorpelstreifen,
den nach seinem Entdecker benannten „Meckelschen Knorpel“
oder den Urunterkiefer (Praemandibula). An der Außenfläche
dieses letzteren entsteht als „Deckknochen oder Belegknochen“
{aus dem Zellenmaterial der Lederplatte) der bleibende knöcherne
Unterkiefer. Aus dem Anfangsteile oder der Basis des zwei ten
Ki eme n b o g e n s entsteht bei den Säugetieren das dritte Gehörknöchelchen,
der Steigbügel; und aus den folgenden Teilen der
Reihe nach: der Steigbügelmuskel, der Griffelfortsatz des Schläfenbeins
, das Griffel-Zungenbeinband und das kleine Horn des
Zungenbeins. Der dritte Ki eme nb o g e n endlich wird nur im
vordersten Teile knorpelig, und hier entsteht durch Vereinigung
seiner beiden Hälften der Körper des Zungenbeins (die Copula
hyoidea). und das große Horn desselben auf jeder Seite. Der
vie r td Ki eme n b o g e n erscheint beim Embryo der Säugetiere
nur vorübergehend als rudimentäres Embryonalorgan, ohne sich
zu besonderen Teilen zu entwickeln; und von den hinteren Kiemenbogen
(fünftes und sechstes Paar), die bei Selachiern bleibend
bestehen, ist beim Embryo der höheren Wirbeltiere überhaupt keine
Spur mehr zu finden. Diese sind längst verloren gegangen. Auch
die vier Ki emensp a l t en des menschlichen Embryo sind bloß
als vorübergehende rudimentäre Organe von Interesse, die durch
Verwachsung bald ganz verschwinden. Nur die erste Kiemenspalte
(zwischen erstem und zweitem Kiemenbogen) hat bleibende
Bedeutung, indem sich aus ihr die Trommelhöhle nebst der
Eustachischen Ohrtrompete entwickelt. (Vergl. Fig. 383, S. 750,
und Fig. 387, S. 753—755-) : '
Wie uns Karl Gegenbaur durch seine mustergültigen „Untersuchungen
zur vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere“ zuerst
das wahre Verständnis des Schädels und seines Verhältnisses zur
Wirbelsäule eröffnet hat, so hat er auch die nicht minder schwierige
und interessante Aufgabe gelöst, das S k e l e t t der G l iedmaßen
bei allen Wirbeltieren von einer und derselben Urform phylogenetisch
abzuleiten. Wenige Teile des Körpers sind bei den verschiedenen
Wirbeltieren durch mannigfaltige Anpassung in Bezug
auf Größe, Form und bestimmte „zweckmäßige Einrichtung“ so
unendlich vielfachen Umbildungen unterworfen, wie die Gliedmaßen
oder Extremitäten; und doch sind wir jetzt im stände, sie
alle auf eine und dieselbe erbliche Grundform zurückzuführen. Im
allgemeinen können wir bezüglich der Gliedmaßenbildung unter
H a e ck e l, Anthropogenie. 5. Aufl. $0