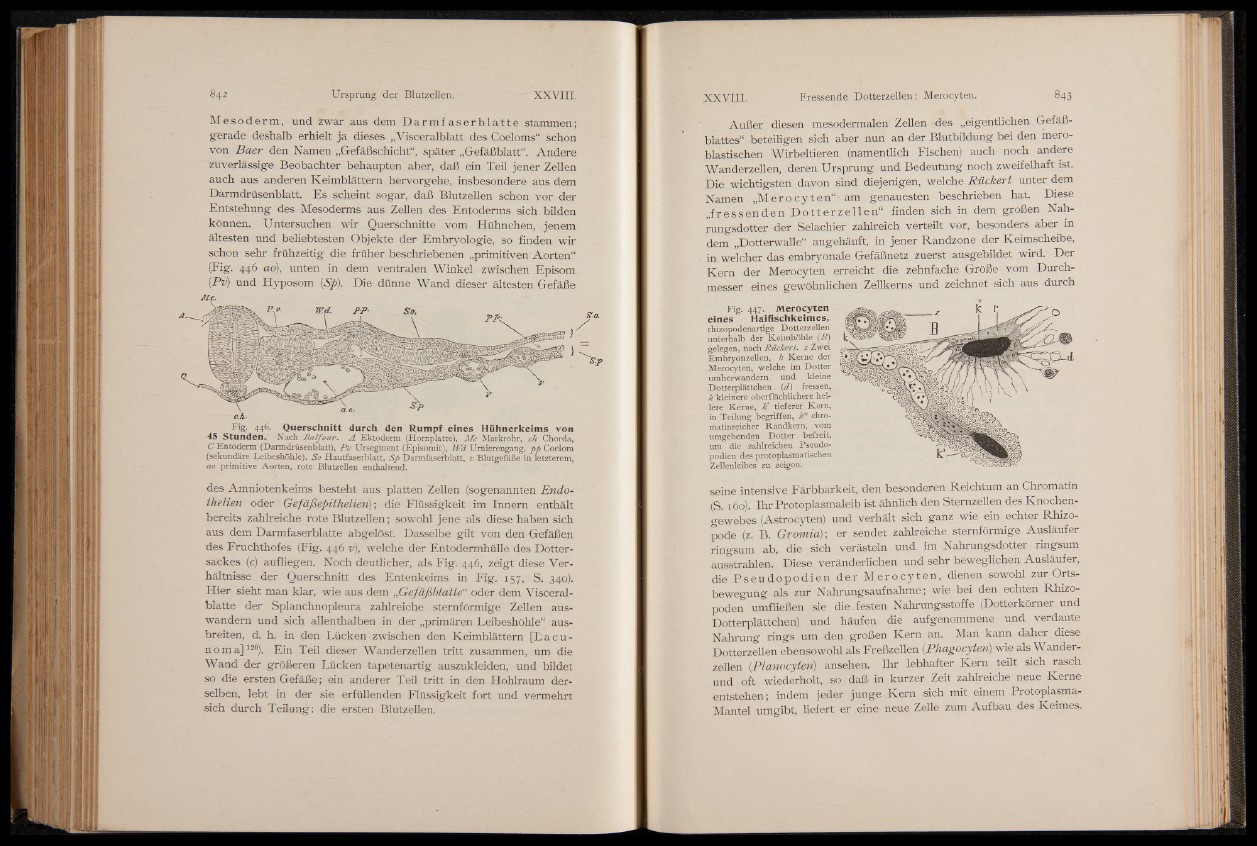
Mesoderm, und zwar aus dem Da rmf a s e rb l a t t e stammen;
gerade deshalb erhielt ja dieses „Visceralblatt des Coeloms“ schon
von Baer den Namen „Gefäßschicht“, später „Gefäßblatt“. Andere
zuverlässige Beobachter behaupten aber, daß ein Teil jener Zellen
auch aus anderen Keimblättern hervorgehe, insbesondere aus dem
Darmdrüsenblatt. Es scheint sogar, daß Blutzellen schon vor der
Entstehung des Mesoderms aus Zellen des Enfoderms sich bilden
können. Untersuchen wir Querschnitte vom Hühnchen, jenem
ältesten und beliebtesten Objekte der Embryologie, so finden wir
schon sehr frühzeitig die früher beschriebenen „primitiven Aorten“
(Fig. 446 ao), unten in dem ventralen Winkel zwischen Episom
(Pv) und Hyposom (Sp). Die dünne Wand dieser ältesten Gefäße
e.k •
Fig. 446. Querschnitt durch den Rumpf eines Hühnerkeims von
45 Stunden. Nach B a lfo u r. A Ektoderm (Homplatte), M c Markrohr, ch Chorda,
C Entoderm (Darmdrüsenblatt), P v Ursegment (Episomit), Wd Ufnierengang, p p Coelom
(sekundäre Leibeshöhle), So Hautfaserblatt, Sp Darmfaserblatt, v Blutgefäße in letzterem,
ao primitive Aorten, rote Blutzellen enthaltend.
des Amniotenkeims besteht aus platten Zellen (sogenannten Endo-
thelien oder Gefäßepithelien); die Flüssigkeit im Innern enthält
bereits zahlreiche rote Blutzellen; sowohl jene als diese haben sich
aus dem Darmfaserblatte abgelöst. Dasselbe gilt von den Gefäßen
des Fruchthofes (Fig. 446 v), welche der Entodermhülle des Dottersackes
(c) aufliegen. Noch deutlicher, als Fig. 446, zeigt diese Verhältnisse
der Querschnitt des Entenkeims in Fig. 157, S. 340).
Hier sieht man klar, wie aus dem „Gefäßblatte“ oder dem Visceralblatte
der Splanchnopleura zahlreiche sternförmige Zellen auswandern
und sich allenthalben in der „primären Leibeshöhle“ ausbreiten,
d. h. in den Lücken zwischen den Keimblättern [Eacu-
noma]120). Ein Teil dieser Wanderzellen tritt zusammen, um die
Wand der größeren Lücken tapetenartig auszukleiden, und bildet
so die ersten Gefäße; ein anderer Teil tritt in den Hohlraum derselben,
lebt in der sie erfüllenden Flüssigkeit fort und vermehrt
sich durch Teilung: die ersten Blutzellen.
Außer diesen mesodermalen Zellen des „eigentlichen Gefäßblattes“
beteiligen sich aber nun an der Blutbildung bei den meroblastischen
Wirbeltieren (namentlich Fischen) auch noch andere
Wanderzellen, deren Ursprung und Bedeutung noch zweifelhaft ist.
Die wichtigsten davon sind diejenigen, welche Rückert unter dem
Namen „Merocyten“ -am genauesten beschrieben hat. Diese
„ fressenden Do t t e r z e l len“ finden sich in dem großen Nahrungsdotter
der Selachier zahlreich verteilt vor, besonders aber in
dem „Dotterwalle“ angehäuft, in jener Randzone der Keimscheibe,
in welcher das embryonale Gefäßnetz zuerst ausgebildet wird. Der
Kern der Merocyten erreicht die zehnfache Größe vom Durchmesser
eines gewöhnlichen Zellkerns und zeichnet sich aus durch
Fig. 447. Merocyten
eines Haifischkeimes,
rhizopodenartige Dotterzellen
unterhalb der Keimhöhle (B)
gelegen, nach Rückert. z Zwei
Embryonzellen, k Kerne der
Merocyten, welche im Dotter
umherwandern und kleine
Dotterplättchen {d) fressen,
£ kleinere oberflächlichere hellere
Kerne, k' tieferer Kern,
in Teilung begriffen, k* chro-
matinreicher Randkern, vom
umgebenden Dotter befreit,
um die zahlreichen Pseudopodien
des protoplasmatischen
Zellenleibes zu zeigen.
seine intensive Färbbarkeit, den besonderen Reichtum an Chromatin
(S. 160). Ihr Protoplasmaleib ist ähnlich den Sternzellen des Knochengewebes
(Astrocyten) und verhält sich ganz wie ein echter Rhizo-
pode (z. B. Gromia); er sendet zahlreiche sternförmige Ausläufer
ringsum ab, die sich verästeln und im Nahrungsdotter ringsum
ausstrahlen. Diese veränderlichen und sehr beweglichen Ausläufer,
die Pseudopodien der Me rocy ten, dienen sowohl zur Ortsbewegung
als zur Nahrungsaufnahme; wie bei den echten Rhizo-
poden umfließen sie die.festen Nahrungsstoffe Potterkörner und
Dotterplättchen) und häufen die aufgenommene und verdaute
Nahrung rings um den, großen Kern an. Man kann daher diese
Dotterzellen ebensowohl als Freßzellen (Phagocyten) wie als Wanderzellen
(Planocyten) ansehen. Ihr lebhafter Kern teilt sich rasch
und oft wiederholt, so daß in kurzer Zeit zahlreiche neue Kerne
entstehen; indem jeder junge Kern sich mit einem Protoplasma-
Mantel umgibt, liefert er eine neue Zelle zum Aufbau des Keimes.