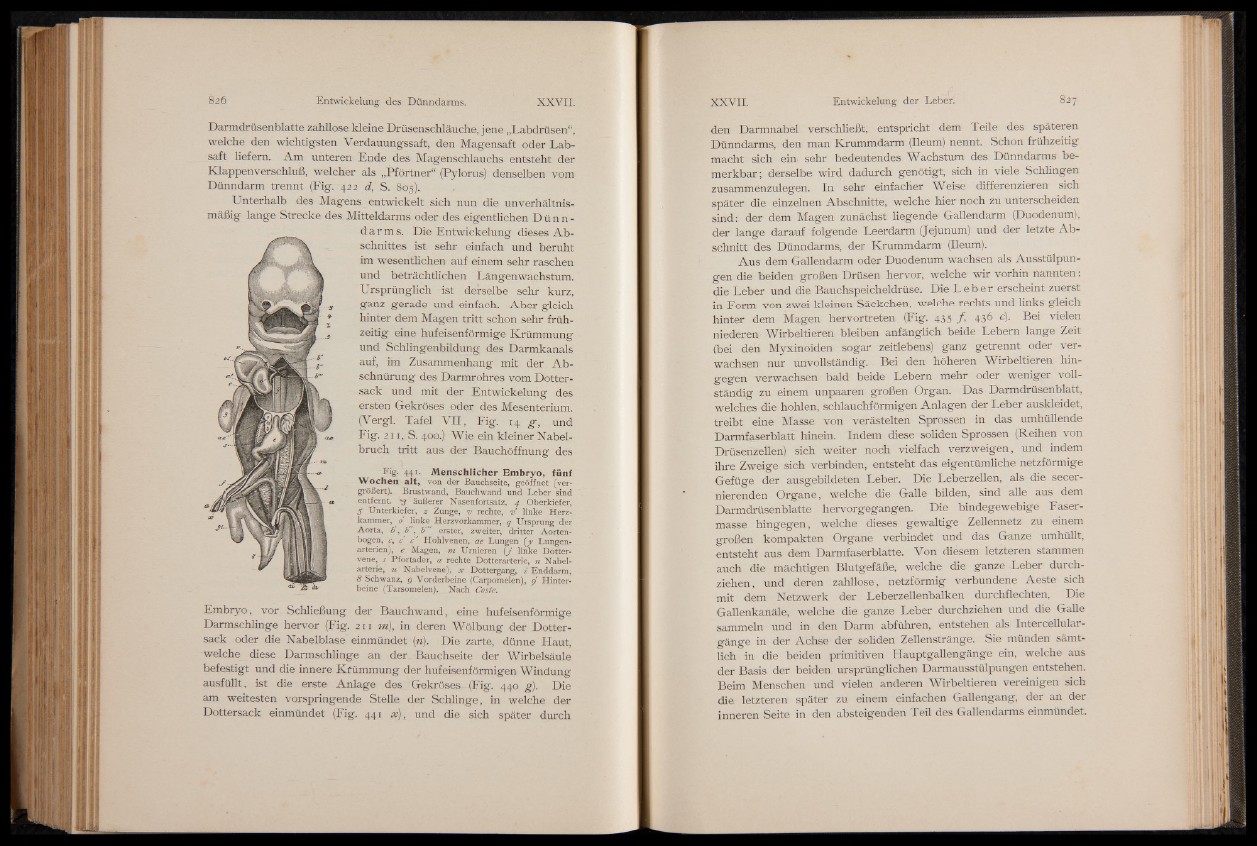
Darmdrüsenblatte zahllose kleine Drüsenschläuche, jene „Labdrüsen“,
welche den wichtigsten Verdauungssaft, den Magensaft oder Labsaft
liefern. Am unteren Ende des Magenschlauchs entsteht der
Klappenverschluß, welcher als „Pförtner“ (Pylorus) denselben vom
Dünndarm trennt (Fig. 422 d, S. 805).
Unterhalb des Magens entwickelt sich nun die unverhältnismäßig
lange Strecke des Mitteldarms oder des eigentlichen Dünndarms.
Die Entwickelung dieses Abschnittes
ist sehr einfach und beruht
im wesentlichen auf einem sehr raschen
und beträchtlichen Längenwachstum.
Ursprünglich ist derselbe sehr kurz,
ganz gerade und einfach. Aber gleich
hinter dem Magen tritt schon sehr frühzeitig
eine hufeisenförmige Krümmung
und Schlingenbildung des Darmkanals
auf, im Zusammenhang mit der Abschnürung
des Darmrohres vom Dottersack
und mit der Entwickelung des
ersten Gekröses oder des Mesenterium.
(Vergl. Tafel VII, Fig. 14 g , und
Fig. 2,11, S. 400.) Wie ein kleiner Nabel-
brueh tritt aus der Bauchöffnung des
Fig. 441. Menschlicher Embryo, fünf
Wochen alt, von der Bauchseite, geöffnet (vergrößert).
Brustwand, Bauchwand und Leber sind
entfernt. äußerer Nasenfortsatz, 4 Oberkiefer,
5 Unterkiefer, z Zunge, v rechte, v linke Herzkammer,
6 linke Herzvöfkammer, q Ursprung der
Aorta, b\ b", b " erster, zweiter, dritter Aortenbogen,
c, c c* Hohlvenen, ae Lungen (jj/ Lungenarterien),
e Magen, m Urnieren ( j linke Dottervene,
s Pfortader, a rechte Dotterarterie, n Nabelarterie,
u Nabelvene), x Dottergang, z Enddarm,
8 Schwanz, p Vorderbeine (Carpomelen), g Hinterbeine
(Tarsomelen). _ Nach Costc.
Embryo, vor Schließung- der Bauchwand, eine hufeisenförmige
Darmschlinge hervor (Fig. 211 m), in deren Wölbung der Dottersack
oder die Nabelblase einmündet (n). Die zarte, dünne Haut,
welche diese Darmschlinge an der . Bauchseite der Wirbelsäule
befestigt und die innere Krümmung der hufeisenförmigen Windung
ausfüllt, ist die erste Anlage des Gekröses (Fig. 440 g). Die
am weitesten vorspringende Stelle der Schlinge, in welche der
Dottersack einmündet (Fig. 441 x), und die sich später durch
den Darmnabel verschließt, entspricht dem Teile des späteren
Dünndarms, den man Krummdarm (Ileum) nennt. Schon frühzeitig
macht sich ein sehr bedeutendes Wachstum des Dünndarms bemerkbar;
derselbe wird dadurch genötigt, sich in viele Schlingen
zusammenzulegen. In sehr einfacher Weise differenzieren sich
später die einzelnen Abschnitte, welche hier noch zu unterscheiden
sind: der dem Magen zunächst liegende Gallendarm (Duodenum),
der lange darauf folgende Leerdarm (Jejunum) und der letzte Abschnitt
des Dünndarms, der Krummdarm (Ileum).
Aus dem Gallendarm oder Duodenum wachsen als Ausstülpungen
die beiden großen Drüsen hervor, welche wir vorhin nannten:
die Leber und die Bauchspeicheldrüse. Die Lebe r erscheint zuerst
in Form von zwei kleinen Säckchen, welche rechts und links gleich
hinter dem Magen hervortreten (Fig. 435 f 436 c)- vielen
niederen, Wirbeltieren bleiben anfänglich beide Lebern lange Zeit
(bei den Myxinoiden sogar zeitlebens) ganz getrennt oder verwachsen
nur unvollständig. Bei den höheren Wirbeltieren hingegen
verwachsen bald beide Lebern mehr oder weniger vollständig
zu einem unpaaren großen Organ. Das Darmdrüsenblatt,
welches die hohlen, schlauchförmigen Anlagen der Leber auskleidet,
treibt eine Masse von verästelten Sprossen in das umhüllende
Darmfaserblatt hinein. Indem diese soliden Sprossen (Reihen von
Drüserizellen) sich weiter noch vielfach verzweigen, und indem
ihre Zweige sich verbinden, entsteht das eigentümliche netzförmige
Gefüge der ausgebildeten Leber. Die Leberzellen, als die secer-
nierenden Organe, welche die Galle bilden, sind alle aus dem
Darmdrüsenblatte hervorgegangen. Die bindegewebige Fasermasse
hingegen, welche dieses gewaltige Zellennetz zu einem
großen kompakten Organe verbindet und das Ganze umhüllt,
entsteht aus dem Darmfaserblatte. Von diesem letzteren stammen
auch die mächtigen Blutgefäße, welche die ganze Leber durchziehen,
und deren zahllose, netzförmig verbundene Aeste sich
mit dem Netzwerk der Leberzellenbalken durchflechten, Die
Gallenkanäle, welche die ganze Leber durchziehen und die Galle
sammeln und in den Darm abführen, entstehen als Intercellular-
gänge in der Achse der soliden Zellenstränge. Sie münden sämtlich
in die beiden primitiven Hauptgallengänge ein, welche aus
der Basis der beiden ursprünglichen Darmausstülpungen entstehen.
Beim Menschen und vielen anderen Wirbeltieren vereinigen sich
die letzteren später zu einem einfachen Gallengang, der an der
inneren Seite in den absteigenden Teil des Gallendarms einmündet.