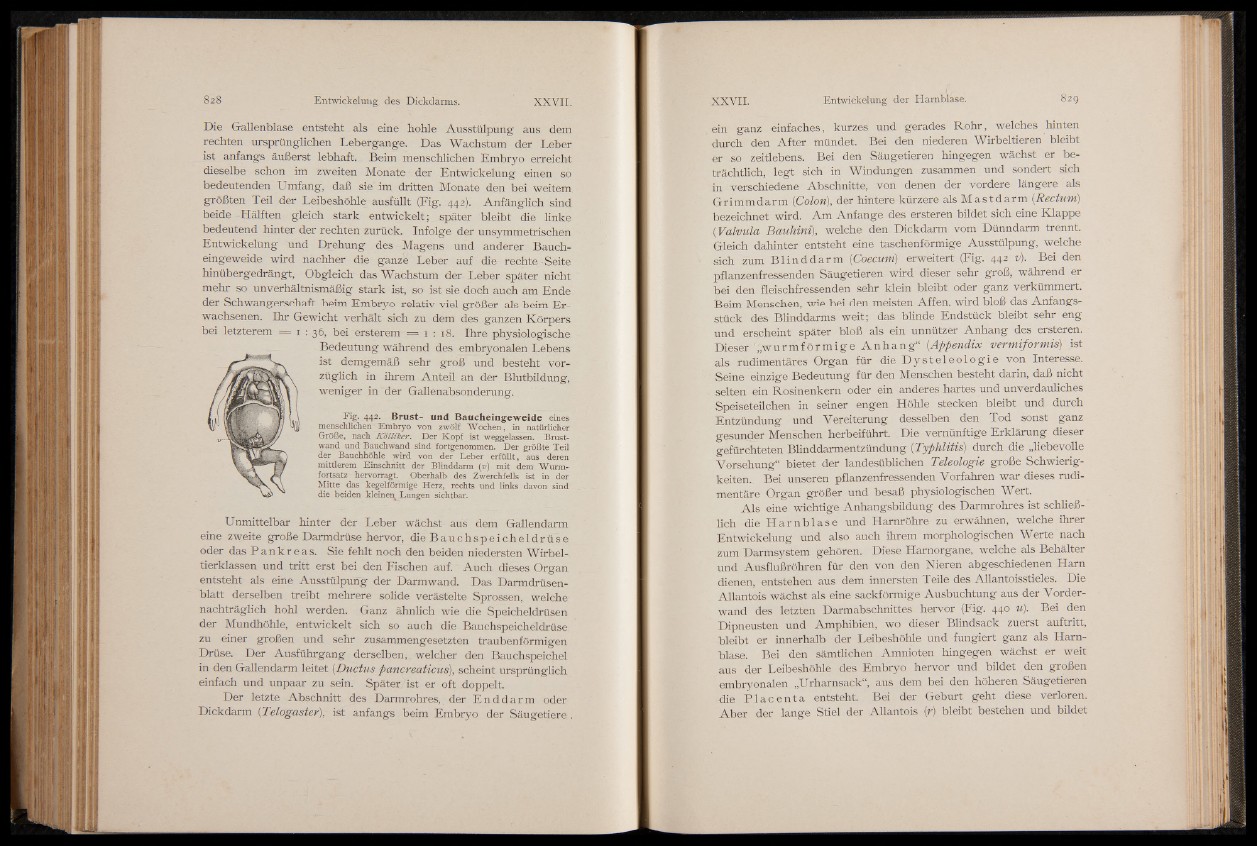
Die Gallenblase entsteht als eine hohle Ausstülpung aus dem
rechten ursprünglichen Lebergange. Das Wachstum der Leber
ist anfangs äußerst lebhaft. Beim menschlichen Embryo erreicht
dieselbe schon im zweiten Monate der Entwickelung einen so
bedeutenden Umfang, daß sie im dritten Monate den bei weitem
größten Teil der Leibeshöhle ausfüllt (Fig. 442). Anfänglich sind
beide -Hälften gleich stark entwickelt ; später bleibt die linke
bedeutend hinter der rechten zurück. Infolge der unsymmetrischen
Entwickelung und Drehung des Magens und anderer Baucheingeweide
wird nachher die ganze Leber auf die rechte Seite
hinübergedrängt, Obgleich das Wachstum der Leber später nicht
mehr so unverhältnismäßig stark ist, -so ist sie doch auch am Ende
der Schwangerschaft beim Embryo relativ viel größer als beim Erwachsenen.
Ihr Gewicht verhält sich zu dem des ganzen Körpers
bei letzterem == 1:36, bei ersterem = 1 : 18. Ihre physiologische
Bedeutung während des embryonalen Lebens
ist demgemäß sehr groß und besteht vorzüglich
in ihrem Anteil an der Blutbildung,
weniger in der Gallenabsonderung.
Fig. 442. Brust- und Baucheingeweide eines,
menschlichen Embryo von zwölf Wochen, in natürlicher
Größe, nach K ö llik er. Der Kopf ist weggelassen. Brustwand
und Bauchwand sind fortgenommen. Der größte Teil
der Bauchhöhle wird von der Leber erfüllt, aus deren
mittlerem Einschnitt der Blinddarm (v) mit dem Wurmfortsatz
hervorragt. Oberhalb des Zwerchfells ist in der
Mitte das kegelförmige Herz, rechts und links davon sind
die beiden kleinen. Lungen sichtbar.
Unmittelbar hinter der Leber wächst aus dem Gallendarm
eine zweite große Darmdrüse hervor, die Bauchspe i che ldrüs e
oder das Pankreas . Sie fehlt noch den beiden niedersten Wirbeltierklassen
und tritt erst bei den Fischen auf. Auch dieses Organ,
entsteht als eine Ausstülpung der Darmwand. Das Darmdrüsenblatt
derselben treibt mehrere solide verästelte Sprossen, welche
nachträglich hohl werden. Ganz ähnlich wie die Speicheldrüsen
der Mundhöhle, entwickelt sich so auch die Bauchspeicheldrüse
zu einer großen und sehr zusammengesetzten traubenförmigen
Drüse. Der Ausführgang derselben, welcher den Bauchspeichel
in den Gallendarm leitet (Ductus pancreaticus), scheint ursprünglich
einfach und unpaar zu sein, Später/ist er oft doppelt.
Der letzte Abschnitt des Darmrohres, der Enddarm oder
Dickdarm (Telogaster), ist anfangs beim Embryo der Säugetiere,
ein ganz einfaches, kurzes und gerades Rohr, welches hinten
durch den After mündet. Bei den niederen Wirbeltieren bleibt
er so zeitlebens. Bei den Säugetieren hingegen wächst er beträchtlich,
legt sich in Windungen zusammen und sondert sich
in verschiedene Abschnitte, von denen der vordere längere als
Grimmdarm [Colon), der hintere kürzere als Mastdarm (Rectum)
bezeichnet wird. Am Anfänge des ersteren bildet sich eine Klappe
(Valvula Bauhini), welche den Dickdarm vom Dünndarm trennt.
Gleich dahinter entsteht eine taschenförmige Ausstülpung, welche
sich zum Bl inddarm (Coecum) erweitert (Fig. 442 v). Bei den
pflanzenfressenden Säugetieren wird dieser sehr groß, während er
bei den fleischfressenden sehr klein bleibt oder ganz verkümmert.
Beim Menschen, wie bei den meisten Affen, wird bloß das Anfangsstück
des Blinddarms weit; das blinde Endstück bleibt sehr eng
und erscheint später bloß als ein unnützer Anhang des ersteren.
Dieser ' „wurmförmige A n h a n g “ (Appendix vermiformis) ist
als rudimentäres Organ für die Dy s t e l e o lo g i e von Interesse.
Seine einzige Bedeutung für den Menschen besteht darin, daß nicht
selten ein Rosinenkern oder ein anderes hartes und unverdauliches
Speiseteilchen in seiner engen Höhle stecken bleibt und durch
Entzündung und Vereiterung desselben den Tod sonst ganz
gesunder Menschen herbeiführt. Die vernünftige Erklärung dieser
gefürchteten Blinddarmentzündung (Typhlitis) durch die „liebevolle
Vorsehung“ bietet der landesüblichen Teleologie große Schwierigkeiten..
Bei unseren pflanzenfressenden Vorfahren war dieses rudimentäre
Organ größer und besaß physiologischen Wert.
Als eine wichtige Anhangsbildung des Darmrohres ist schließlich
die Ha rnbla s e und Harnröhre zu erwähnen, welche ihrer
Entwickelung und also auch ihrem morphologischen Werte nach
zum Darmsystem gehören. Diese Harnorgane, welche als Behälter
und Ausflußröhren für den von den Nieren abgeschiedenen Harn
dienen, entstehen aus dem innersten Teile des Allantoisstieles. Die
Allantois wächst als eine sackförmige Ausbuchtung aus der Vorderwand
des letzten Darmabschnittes hervor (Fig. 440 «). Bei den
Dipneusten und Amphibien, wo dieser Blindsack zuerst auftritt,
bleibt er innerhalb der Leibeshöhle und fungiert ganz als Harnblase.
Bei den sämtlichen Amnioten hingegen wächst er weit
aus der Leibeshöhle des Embryo hervor und bildet den großen
embryonalen „Urharnsack“, aus dem bei den höheren Säugetieren
die Pla c en t a entsteht. Bei der Geburt geht diese verloren.
Aber der lange Stiel der Allantois (r) bleibt bestehen und bildet