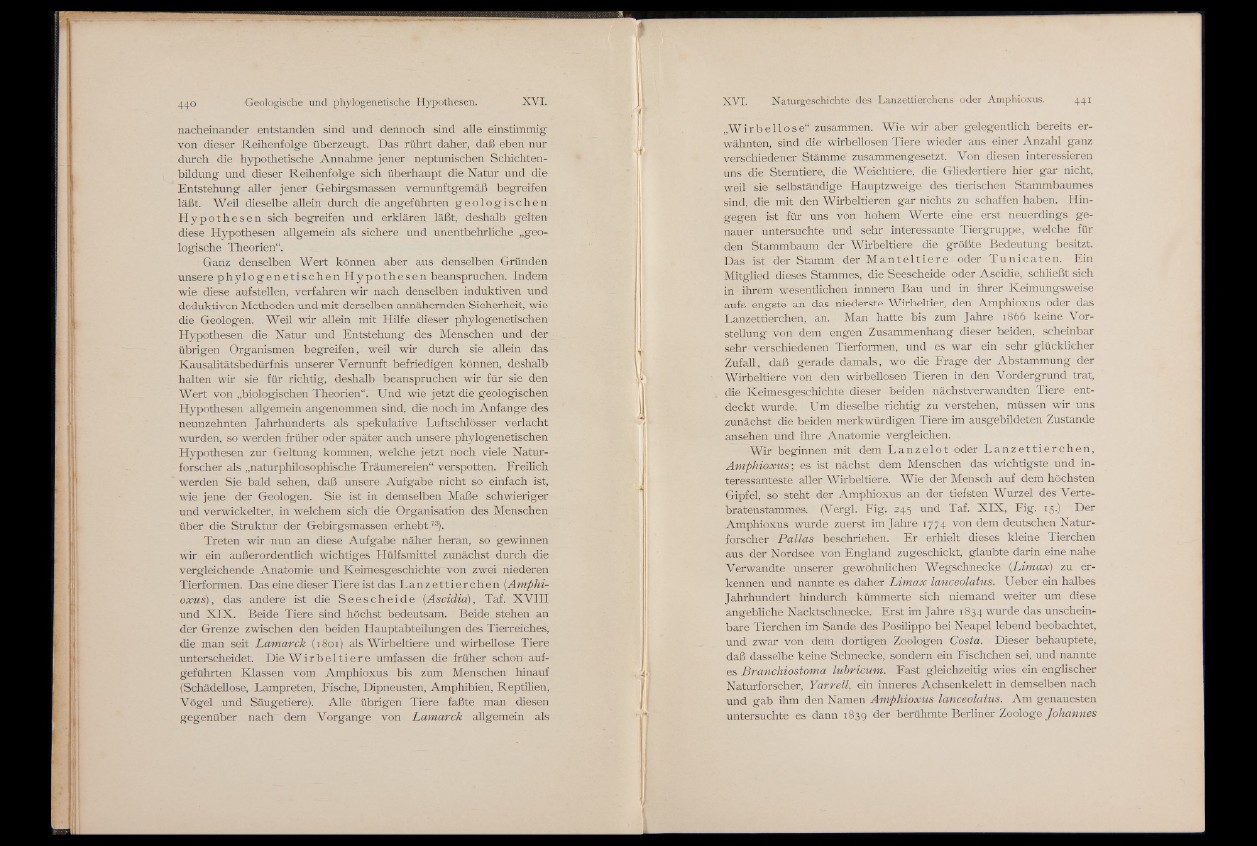
nacheinander entstanden sind und dennoch sind alle einstimmig"
von dieser Reihenfolge überzeugt. Das rührt daher, daß eben nur
durch die hypothetische Annahme jener neptunischen Schichtenbildung
und dieser Reihenfolge sich überhaupt die Natur und die
Entstehung aller jener Gebirgsmassen vernunftgemäß begreifen
läßt. Weil dieselbe allein durch die angeführten g e o lo g i s ch en
Hypothe s en sich begreifen und erklären Jäßt, deshalb gelten
diese Hypothesen allgemein als sichere und unentbehrliche „geologische
Theorien“.
Ganz denselben Wert können aber aus denselben . Gründen
unsere ph y lo g ene t i s chen Hypothe s en beanspruchen. Indem
wie diese aufstellen, verfahren wir nach denselben induktiven und
deduktiven Methoden und mit derselben annähernden Sicherheit, wie
die Geologen. Weil wir allein mit Hilfe dieser phylogenetischen
Hypothesen die Natur und Entstehung des Menschen und der
übrigen Organismen begreifen, weil wir durch sie allein das
Kausalitätsbedürfnis unserer Vernunft befriedigen können, deshalb
halten wir sie für richtig, deshalb beanspruchen wir für sie den
Wert von „biologischen Theorien“. Und wie jetzt die geologischen
Hypothesen allgemein angenommen sind, die noch im Anfänge des
neunzehnten Jahrhunderts als spekulative Luftschlösser verlacht
wurden, so werden früher oder später auch unsere phylogenetischen
Hypothesen zur Geltung kommen, welche jetzt noch viele Naturforscher
als „naturphilosophische Träumereien“ verspotten. Freilich
werden Sie bald sehen, daß unsere Aufgabe nicht so einfach ist,
wie jene der Geologen. Sie ist in demselben Maße schwieriger
und verwickelter, in welchem sich die Organisation des Menschen
über die Struktur der Gebirgsmassen erhebt-7?).1
Treten wir nun an diese Aufgabe näher heran, so gewinnen
wir ein außerordentlich wichtiges Hülfsmittel zunächst durch die
vergleichende Anatomie und Keimesgeschichte von zwei niederen
Tierformen. Das eine dieser Tiere ist das Lanzettierchen (Amphi-
oxus), das andere ist die Se e s che ide (Ascidia), Taf. XVIII
und XIX. Beide Tiere sind höchst bedeutsam. Beide stehen an
der Grenze zwischen den beiden Hauptabteilungen des Tierreiches,
die man seit Lamarck. (1801) als Wirbeltiere und wirbellose Tiere
unterscheidet. Die Wi rb e l t i e r e umfassen die früher schon aufgeführten
Klassen vom Amphioxus bis zum Menschen hinauf
(Schädellose, Lampreten, Fische, Dipneusten, Amphibien, Reptilien,
Vögel und Säugetiere). Alle übrigen Tiere faßte man diesen
gegenüber nach dem Vorgänge von Lamarck allgemein als
„Wi rbe l lose “ zusammen. Wie wir aber gelegentlich bereits erwähnten,
sind die wirbellosen Tiere wieder aus einer Anzahl ganz
verschiedener Stämme' zusammengesetzt. Von diesen interessieren
uns die Sterntiere, die Weichtiere, die Gliedertiere hier gar nicht,
weil sie selbständige Hauptzweige des tierischen Stammbaumes
sind, die mit den Wirbeltieren gar nichts zu schaffen haben. Hingegen
ist für uns von hohem Werte eine erst neuerdings genauer
untersuchte und sehr interessante Tiergruppe, welche für
den Stammbaum der Wirbeltiere die größte Bedeutung besitzt.
Das ist der Stamm der Mante l t ie r e oder Tuni caten. Ein
Mitglied dieses Stammes, die Seescheide oder Ascidie, schließt sich
in ihrem wesentlichen innnern Bau und in ihrer Keimungsweise
aufs engste an das niederste Wirbeltier, den Amphioxus oder das
Lanzettierchen, an. Man hatte bis zum Jahre 1866 keine Vorstellung
von dem engen Zusammenhang dieser beiden, scheinbar
sehr verschiedenen Tierformen, und es war ein sehr glücklicher
Zufall, daß gerade damals, wo die Frage der Abstammung der
Wirbeltiere von den wirbellosen Tieren in den Vordergrund trat,
die Keimesgeschichte dieser beiden nächstverwandten Tiere entdeckt
wurde. Um dieselbe richtig zu verstehen, müssen wir uns
zunächst die beiden merkwürdigen Tiere im ausgebildeten Zustande
ansehen und ihre Anatomie vergleichen.
Wir beginnen mit dem Lanz e lo t oder Lanz e t t ie r chen,
Amphioxus, es ist nächst dem Menschen das wichtigste und interessanteste
aller Wirbeltiere. Wie der Mensch auf dem höchsten
Gipfel, so steht der Amphioxus an der tiefsten Wurzel des Vertebratenstammes.
(Vergl. Fig.. 24,5 und Taf. XIX, Fig. 15.) Der
Amphioxus wurde zuerst im Jahre 1774 von dem deutschen Naturforscher
Pallas beschrieben. Er erhielt dieses kleine Tierchen
aus der Nordsee von England zugeschickt, glaubte darin eine nahe
Verwandte unserer gewöhnlichen Wegschnecke (Limax) zu erkennen
und nannte es daher Limax lanceolatus. Ueber ein halbes
Jahrhundert hindurch kümmerte sich niemand weiter um diese
angebliche Nacktschnecke. Erst im Jahre 1834 wurde das unscheinbare
Tierchen im Sande des Posilippo bei Neapel lebend beobachtet,
und zwar von dem dortigen Zoologen Costa. Dieser behauptete,
daß dasselbe keine Schnecke, sondern ein Fischchen sei, und nannte
es Branchiostoma lubricum. Fast gleichzeitig wies ein englischer
Naturforscher, Yarrell, ein inneres Achsenkelett in demselben nach
und gab ihm den Namen Amphioxus lanceolatus. Am genauesten
untersuchte es dann 1839 der berühmte Berliner Zoologe Johannes